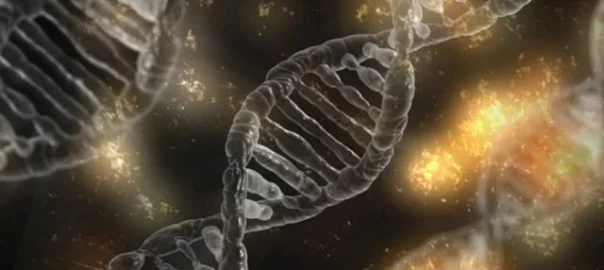Die Sorge des Arztes (545-546)
Im folgenden sollen die Themen der Kapitel und der Unterkapitel aus den Texten von Ernst Bloch, aus dem Prinzip Hoffnung, zusammengefasst und in gesundheitswissenschaftlicher Weise interpretiert werden. Die Leitfrage dabei ist: welche Aktualität haben die Bloch’schen Überlegungen (noch) für heutige gesundheitswissenschaftliche Probleme? Oder auch: was sagt uns das Prinzip Hoffnung zu den sozialtheoretischen Grundlagen des Problems individueller und kollektiver Gesundheit?
Ein Träumer will mehr (Kapitel 33):
In dem kurzen Kapitel thematisiert Bloch das Suchen des Einzelnen nach „mehr“, seine Konstitution, seine Genese, sein Schicksal als „Träumer“ (523). Die Motivation zu suchen, erblickt der Einzelne darin beziehungsweise dadurch, das zu überwinden, was fehlt, von dem es erträumt wird.: „Wovon geträumt wird, dessen Fehlen tut nicht weniger weh, sondern mehr. So hindert das, sich an die Not zu gewöhnen. Was immer wehtut, drückt und schwächt, soll weg.“ (Ebd.)
Dem stetigen „Suchen“ liegt ein Wille zu Grunde. Ein Wille, der danach strebt, „nicht nur über die eigenen, sondern über die schlecht vorhandenen Verhältnisse insgesamt zu leben“. (Ebd.) Die Ernsthaftigkeit des Willens zeigt sich, so Bloch, darin, dass der Einzelne bestimmt daran festhält, es ihm Ernst wird, „wenn der Weg richtig und sorgend vorwärts geht.“
Gesundheitswissenschaftlich lässt sich hier nicht viel interpretieren. Lediglich der Satz, „das was wehtut, soll weg“, deutet darauf hin, dass fehlende Gesundheit beziehungsweise genauer Krankheit, also Einschränkung und Leid, nicht erstrebenswert sind, von ihnen also nicht geträumt wird und sie schon gar nicht erträumt werden wollen. Die Sehnsucht treibt an, befördert den Träumenden ins Reich der „realen Utopien“, von dessen Geschichte, Möglichkeiten und Bedingungen der Rest des vierten und fünften Teils von Blochs: „Das Prinzip Hoffnung“ bekanntlich handelt. Welchen Träumen, welchen Sehnsüchten, welchen Utopien folgt das individuelle wie soziale Streben nach Gesundheit, nach guter Leiblichkeit? Diese Fragen thematisiert Bloch in den nächsten beiden Kapiteln.
Übungen des Leibs, tout va bien (Kapitel 34):
In diesem Abschnitt beschäftigt sich Ernst Bloch in geradezu psychosozialer Weise oder gesundheitssoziologischer Weise mit der Frage: „Wie bleiben wir gesund […] wie ernährt man sich gut und billig.“ (523) Der Ausgangspunkt seiner Reflexion in diesem kurzen Kapitel ist eine aphoristische Einleitung in die Grundlagen der Gesundheitssoziologie: „Nur was klein ist, drückt nach unten. Das Kind hat nichts zu melden, die Frau kocht und wäscht, der Arme steht krumm, nicht viele werden noch täglich einmal satt.“ (Ebenda)
Hier werden in zuspitzender Diktion nicht nur verschiedene Herrschaftsverhältnisse angesprochen (entrechtete Kindheit und patriarchale Herrschaft sowie kapitalistische Armut), sondern auch, wie man unter diesen Bedingungen überhaupt gesund bleiben kann oder noch existenzieller, sich „gut“ zu ernähren vermag. Ernst Bloch deutet die Antwort an: „Wo ist der grüne Ast, er kann an anderen gesehen werden, sie sitzen darauf. Vierzehn Tage frei, das ist schon sehr viel für die meisten, dann zurück in ein Leben, das keiner will. Die frische Luft steht hier für viel, was strahlen könnte.“ (523f.) Es gibt also, so die Schlussfolgerungen, soziale Hierarchien, soziale Ungleichheiten, die unterschiedliche, nämlich ungleiche, Gesundheitschancen oder eben, andersherum, sozial differenzierte Krankheitswahrscheinlichkeiten und frühzeitigen Tod verursachen. Das ist das große Thema der Gesundheitssoziologie, insbesondere der Sozialepidemiologie.
Den nächsten beiden Absätzen intoniert Ernst Bloch eine kritische Soziologie des Sportes. Offenbar ausgehend von dem noch heute üblichen: „Bewege dich doch, geh‘ doch nach draußen“, wird die „frischere Luft“ (524) zum Ausgangspunkt der Leibesübungen in der bürgerlichen Gesellschaft. Heute würde man wohl den Bürgerinnen und Bürgern nahelegen, sich ins Fitnessstudio zu begeben, wenn ein Sport im Freien nicht möglich ist.
Doch die Stärkung des „Sportherzens“, dass „das Bierherz verdrängt“ habe, unter „bürgerlichen Zuständen“, ist ambivalent. Denn Sport mache unter diesen Bedingungen „dumm“, werde also deshalb „von oben gefördert“. Das liege nicht nur daran, dass das „Verbessern der Rekorde“ den „freien Wettbewerb“ verdrängt habe, eine Anspielung auf die marxistische Theorie des Monopolkapitalismus (z.B. Varga 1929), der den liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts ersetzt hat, sondern insbesondere darauf, dass sich durch Sport alleine keineswegs die krankmachenden sozialen Verhältnisse ändern (lassen). Oder wie es Bloch aphoristisch ausdrückt: „Ein kräftiges Bedürfnis treibt die Massen ins Freie, aber das Wasser reinigt nur die Körper, und die Wohnung, zu der der Freiluftmensch abends heimkehrt, ist nicht frischer geworden.“ (524)
Mit dieser bürgerlichen Stützung der Idee des Sports ist nicht nur die Idee des Turnvater Jahns, dass die „Seele des Tonwesens“ das „Volksleben“ sei, im Verlauf der deutschen Geschichte pervertiert worden, indem vergessen wurde, den Kopf, den Intellekt in die Ertüchtigung einzubeziehen. Die Folgen, so Bloch, waren katastrophal: „Leibesübungen, ohne die des Kopfes, hieß schließlich: Kanonenfutter sein und vorher Schläger.“ Er geht noch weiter: „Es gibt keinen unpolitischen Sport; ist er frei, so steht er links, ist er verblendet, so vermietet er sich an rechts. Und erst in einem ungedeckten Volk, in einem, wo der tüchtige Leib wieder mißbraucht wird noch als Ersatz für Männerstolz steht, wird Jahns Wunsch sinnvoll.“ (524f.)
Dabei stecke in dem Gedanke der sportlichen Übung eine hoffende Inspiration: „Sie will des Körpers nicht nur mächtig werden, derart, daß an ihm kein Fett ist und jede Bewegung wohlig – ungehemmt hergeht. Sie will auch mit dem Körper mehr machen, mehr sein können, als ihm an der Wiege gesungen wurde.“ (525) Bloch erkennt den noch heute gültigen, wenn nicht sogar hoch aktuellen, „bürgerlichen Notstand“, den der Sport abwehren kann und der darin besteht für einen „Ausgleich“ zur „überwiegend sitzenden Lebensweise“ zu sorgen. Diesem bürgerlichen Notstand weist Bloch eine zukünftige Bedeutung zu: sie werde es immer geben, aber er legt den Finger auch in die Wunde, dass die Stubenarbeiter keineswegs immer die Verheißung „frischer Luft“ im Kapitalismus bekommen. Wie wir bereits wissen: Sport allein schafft keine frische Luft in den sozialen Verhältnissen. Diese müssen sein Erleben und Aktivsein auch ermöglichen, sei es durch hilfreiche betriebliche oder private Lebensbedingungen, sei es durch Zeit und Muße.
Denn diese sozialen Verhältnisse einer entfremdeten Gesellschaft sind es, die dem Köper „Verzerrungen und Entstellungen“ zufügen, die Sport alleine wohl nicht in der Lage ist zu beseitigen, auch wenn die sportlichen Hoffnungen darauf beruhen: „Es ist ein sportlicher Wunsch, seinen Leib derart in der Hand zu haben, dass noch auf der Sprungschanze, wenn der Mensch fliegt, jede Lage vertraut ist, auch die neue, übertriebene.“ (525)
Den Körper zu kontrollieren, ist heutzutage wohl die verbreiteste Religion der spätmodernen Gesellschaften. Und hier zeigt sich eine Aktualisierungsnotwendigkeit von Ernst Blochs Gedanken. Die zunehmende und erwünschte Kontrolle des eigenen und des kollektiven Leibs (siehe Foucaults Biopolitik), über jede Verzerrung und Entstellung, die der Kapitalismus hervorruft, ist im heutzutage anzutreffenden flexiblen Kapitalismus (Lessenich 2009) in das Individuum zurückverlagert worden, nachdem zunächst die Gesundheitsbedingungen am Arbeitsplatz nach dem Zweiten Weltkrieg, auch durch gewerkschaftliche Strategie, kollektiv gestärkt wurden. Der nunmehr allzeit beobachtbare Arbeitskraftunternehmer (Bongratz 2001) hat es nun nicht nur (vermeintlich) selbst in der Hand, sondern ist vielmehr durch die neuen marktförmigen Produktionsformen (Dörre/Röttger 2003) gezwungen, seine eigene Gesundheit aufrecht zu erhalten. Das gelingt freilich nur wenigen, die in prosperierenden Branchen leben oder sich komplett aus dem Arbeitsleben zurückgezogen haben, mit der Gefahr der sozialen Marginalisierung Unten, die auch nicht gesundheitsförderlich ist, und dem arbeitslosen Luxus Oben in der sozialen Hierarchie freilich. Dennoch zeigt der Verweis auf Foucaults Biopolitik, dass diese auch von Bloch beschriebene Belagerung der Körper als Herrschaftsfolie offenbar strukturell bedingt ist und keineswegs völlig neu im 21. Jahrhundert auftritt. Die Historie der Körperkulte ist eine lange (Griechen, Römer, Renaissance, Neuzeit, Faschismus, Neoliberalismus).
Bloch thematisiert diese biopolitische Ideologie ebenfalls in der Diskussion der Bedeutung von Medizin, Arzttum und Heilkunde in den sog. „Staatsutopien“ eines Platon, Bacon oder Morus (S. 539f.) Im Kapitalismus – so lässt sich realhistorisch schlussfolgern – hat sich die positiv besetzte („gesunde“) Körperlichkeit erst (kriegs-)staatlich vermittelt gegen die todbringende Ausbeutung der Körper im kapitalistischen Inneren der Gesellschaften durchsetzen müssen und wurde nach außen zudem rassistisch überhöht und kolonialistisch pervertiert und „externalisiert“, indem nun stattdessen fremde Körper vernichtet wurden – von den (verbliebenen) Elenden der (angeblich) post-industrialierten Welt des 21. Jahrhunderts einmal abgesehen.
Der abschließende Absatz im 34. Kapitel, der sich mit der Bewegung der positiven Psychologie und der Autosuggestion des französischen Apotheker und Psychologen Émile Coué auseinandersetzt, ist so betrachtet geradezu prophetisch beziehungsweise verweist auf langlebiege Strukturhomologien im Kapitalismus jedweder Zeit. Die Überwindung von Armut, Ausbeutung, Stresszuständen oder Herausforderungen, die krank machen können, mit der Autosuggestion: „alles ist gut“, wie es Coué empfohlen hat und noch heute in der positiven Psychologie reüssiert, ist hochgradig problematisch. Ernst Bloch weist damit schon früh und hochaktuell auf die Gefährdung der positiven Psychologie hin: „Hier ist das gefährliche Vorbild für das Wegsehen vom Übel; indem es ignoriert wird, soll es wie nicht da sein.“ (526)
Doch Bloch wäre nicht der dialektische Bloch, wenn er nicht erkennen würde, dass selbst in dieser Gefahr der positiven Psychologie doch auch ein „Schuss Wahres an der Sache“ (526) liege. Die mögliche „hellere Stimmung“ könne die Schlappheit beenden, die auch eine Krankheit sein könne. Zwar ist nicht alles gut, aber der Wille, der sich in der Überwindung der Schlappheit ausdrücken könnte, so ein Zeichen, „daß ein Wille auf seinem Weg ist.“ (526) Man fühlt, die „Selbstwirksamkeit“ (Bandura) oder den „Kohärenzsinn“ (Antonovsky), Konzepten aus der Zukunft der Gesundheitssoziologie und -psychologie, in das Bloch’sche Werk hineinschauen.
Da unser Körper sich verändere, nutze es keineswegs, sich nur stets „alles ist gut“ einzureden. Dennoch bleibt der „Traum des Besseren“ in Bezug auf das Leibliche vorhanden. Hier tritt die Medizin beziehungsweise der Arzt auf dem Plan: „Diesem [träumenden] Mann kann durchaus geholfen werden, samt dem Weib, auf der planbare Straße [der Medizin].“ (526)
Exkurs: Chat GPT-Recherche zu „Coué“:
„Ja, natürlich! Der „Coué“, auf den in Ernst Blochs Buch „Das Prinzip Hoffnung“ hingewiesen wird, ist wahrscheinlich Émile Coué, ein französischer Apotheker und Psychologe, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert lebte. Er ist am bekanntesten für seine Entwicklung der sogenannten „Autosuggestion“ oder „Selbstbeeinflussung“.
Coué glaubte, dass die Kraft des positiven Denkens und der Autosuggestion dazu verwendet werden kann, physische und psychische Probleme zu überwinden und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Sein berühmtestes Mantra war „Tout va bien“ (Alles ist gut), das er seinen Patienten empfahl, regelmäßig zu wiederholen, um ihr Selbstvertrauen zu stärken und positive Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken.
Ernst Bloch erwähnt wahrscheinlich Coué in seinem Buch, um auf die Bedeutung von Hoffnung, Selbstvertrauen und positivem Denken für das menschliche Leben hinzuweisen. Coués Ideen hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Selbsthilfe- und positiven Psychologie und haben bis heute Anhänger.“
(Antwort von Chat GPT, 12.05.24, Anfrage meinerseits: „Was kannst du mit dem Namen „Coué“ und der Aussage „tout va bien“ anfangen. Es muss sich hier um einen Gesundheitsapostel oder Arzt handeln, der Gesundheitstipps im 18. oder 19. Jahrhundert angepriesen hat. Auf diesen „Coué“ wird in Ernst Blochs Buch: „Das Prinzip Hoffnung“ hingeweisen. Kannst du mir hier helfen, herauszufinden, wer dieser „Coué“ war?“)
Kampf um Gesundheit, die ärztlichen Utopien (Kapitel 35)
Die ärztlichen Utopien sind derer viele. Sie sind angelegt in der Wunsch nach einem „wärmenden Bett“ des Kranken, sich gewissermaßen im Schlafe „gesund“ zu fühlen, oder wie der Volksmund sagt(e): „Ach, Herr Doktor, wenn ich liege, geht es mir gleich besser.“ Die medizinischen Wunschträume wurzeln in den anthropologischen Konstanten einer Utopie des „Gesundseins“ (KM), die sich gegen Schmerz, Krankheit und Tod wendet. Die medizinischen Pläne entwickeln sich historisch aus der mittelalterlichen Volksmedizin und Kräuterlehre, die etwas auch Umberto Eco in seinem wunderbaren Romen „Der Name der Rose“ blumig in ihrer Doppeldeutigkeit beschreibt („drug“ auf Englisch heißt bekanntlich: Droge und Arzneimittel, eine Apotheke ist ein „drug store“; ein Zusammenhang, der im Deutschen ein wenig verloren gegangen ist; liegt es an der Ikonisierung der deutschen Pharmazie als „Apotheke der Welt“ in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts?).
Auch ärztliche, medizinische Utopien sind folglich selbst zum Teil irre Märchen geworden, die im Zuge der Verwissenschaftlichung und Industrialisierung der Medizin im 20. Jahrhundert zum Teil aber sehr real geworden sind. Tod, Krankheit und Wunsch nach ewiger Jugend werden zu utopisch zu überschreitenden „Grenzen“, „Frontiers“, wie die Angloamerikaner sagen, der medizinischen Planung und Arzneianwendung erklärt.
Ein warmes Bett
In diesem ersten Abschnitt betrachtet Bloch das „Kranksein“ aus der psychologischen Perspektive des träumenden Wünschens eines Kranken. Die Krankheit soll verschwinden, das, was krank ist, wird als Last empfunden, als ein Zuviel des Guten beziehungsweise Schlechten. Im „warmen Bett“ fühlt sich der Kranke, weil schlafend, gesund, weil er eben sich nicht fühlt. Im Wachzustand dagegen soll das Unbehagen „als ein Herumhängendes, Überflüssiges weg, Schmerz ist wildes Fleisch. Vom Leib wird geträumt, der wieder auch behaglich zu schweigen weiß. “ (527)
Irre und Märchen
Der erste Abschnitt in diesem Kapitel, der sich mit ärztlichen Utopien beschäftigt, thematisiert die Quellen beziehungsweise Wege, wie der Wunsch des Kranken, „im Nu gesund zu werden“ (527), in die Realität umgesetzt werden kann. Ein „ehrlicher Arzt“, so Bloch, könnte das dem Kranken nicht geben, daher würden die Herzenswünsche des Menschen und Kranken: jung zu bleiben, lange zu leben und alles beide „nicht auf schmerzlichen Umwegen, sondern überrumpelnd, märchenhaft zu erlangen“ (527) von Irren und Märchen genährt.
Ernst Bloch beschreibt den sprichwörtliche Kurpfuscher, der diese Wünsche bediene und mit Salben, Heilgetränken oder auch Heilwasser und allerlei Theatralisches und Getue am Leben zu erhalten pflege, um davon zu leben. Genannt werden historische Beispiele eines Grafen St. Germain, Mesmers und Dr. Graham (528), die auf unterschiedliche Weise den Leichtglauben des Kranken beziehungsweise Nicht-krank-werden Wollenden ausnutzten.
Doch nicht nur semi – professionelle oder kommerzielle Kurpfuscher laben sich an dem Wunsch, „im Nu gesund zu werden“, sondern auch die wesentlich ältere Kunst der Kräuterlehre neigt zur falschen Prophetie. Doch bereits hier und noch mehr in sämtlichen „groß– medizinischen Pläne[n]“ (528) zeige sich blitzartig auch die Wirksamkeit des „Ungemeinen“. Die Medizin macht gewissermaßen perplex: „Es ist immer ein Abenteuerliches und Sonderbares in ihnen, im Gift, das nicht tötet, sondern schmerzfrei macht, im Messer, das nicht mordete, sondern heilt, im Grenzgebilde mit dem künstlich hergestellten Magen.“ (528) Auch die Medizin setzt also beim Hoffnungsglauben des Kranken an, kreiert „Märchen“.
Obwohl das derart „Geflickte“ keineswegs besser oder zuverlässiger funktioniere als das natürliche, „gesunde Organ“, lässt sich nicht leugnen, dass die Medizin, der Arzt etwas (be-)wirke: „Die Krankheit ist nicht abgeschafft, aber ihr Ende: der Tod, ist verblüffend zurückgedrängt.“ (528)
Die Medizin, der Arzt, so Bloch zum Abschluss des Unterabschnitts, könne im Grunde zufrieden sein mit seiner Wirkung in den letzten 100 Jahren, wenn denn da nicht die Staaten wären, die in Tagen (qua „Ausbeutung“ und „Krieg“) nachholten, „was in Jahren an Sterben versäumt wurde“ (528).
Auch an dieser Stelle kommt Ernst Bloch damit mit der Betonung der Grenzen der Medizin, die in den gesellschaftlichen Determinanten (hier: Ausbeutung und Krieg) begründet sind. Dennoch wendet sich Bloch mit dem letzten Satz seines Unterkapitels bereits den grundlegenden ärztlichen Utopien zu, die zu seiner Zeit und vielleicht auch noch heute die Medizin und die Menschen angetrieben haben, wenn er schreibt, dass das Lager, „von dem der Kranke aufsteht“ erst dann vollkommen wäre,„wenn er erfrischt statt nur gepflegt wäre.“ (529) Im nächsten Abschnitt über die medizinischen Träume zur Bearbeitung menschlicher Gesundheits- und Existenzwünsche sucht er nach den Quellen der Erfrischung des Menschen durch die Medizin.
Arznei und Planung
„Erfrischung“ meine, so Bloch (S. 529), „nichts weniger, als den Leib umzubauen“, was bisher natürlich nicht möglich gewesen sei. Hierzu zählt er die „schmerzstillenden Mittel“, die „narkotische[r] Betäubung“ oder auch Arzneimittel, eben auch: Gifte. Das Gemeinsame ist: „All das ist künstlich und liegt nicht in der Linie des ohnehin vorhandenen Selbstschutzes, der ohnehin möglichen Regenerierung.“ (S. 530)
Selbst in den „Staatsmärchen“ (s. bereits oben) eines Platon, Morus etc. wird dem staatlichen Drang nach „einem besseren Leben“ (ebd.) Genüge getan, indem der „hinfällige Körper“ in ihnen verschwindet. Heilkunde und Dietätik werden zu beispielhaften Instrumenten eines „neu aufgebauten Lebens“ (ebd.). In diesen „Staatsmärchen“ verwandelt sich der Arzt (die Medizin) in eine erträumte Instanz, die in der Lage ist, „einen weniger anfälligen Leib zu bilden.“ (Ebd.)
Hiermit ändert sich die Rolle des Arztes grundlegend: Er wird „hier überall nicht als Schuhflicker gedacht, der schlecht und recht das Alte wieder herrichtet. Sondern er wird als Erneuerer gewünscht, das Fleisch nicht nur von seiner erworbenen, sondern sogar von seiner angeboreren Schwäche befreiend.“ (Ebd.)
Der Arzt als exekutive Instanz eines „neuen Menschen“, einer „progressiven“ (?, KM) Eugenik etwa? Aus diesen Staatsmärchen ist es kein weiter Weg mehr zu der Foucault’schen biopolitischen Tendenz in der Moderne und den eugenischen Programmen totalitärer Staats- und Regierungsformen in der ersten und zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (medizinischer und psychologischer Totalitarismus), wie Bloch selbst erläutert (S. 531ff.).
Wie die Foucault’sche Biopolitik unterstellt Bloch den staatlichen wie ärztlichen Utopien dabei ein vitales Interesse an der „Regierung der Körper“ (Turner 2004: 60ff.), auch und besonders dem „gesunden Leib“ (Bloch 1985: 530) und nicht nur dem „kranken“
Im weitern Verlauf des Unterkapitels thematisiert Bloch drei (anthropologische) „Pläne“ in staatlichen und ärztlichen Utopien, die von verblüffender bzw. erschreckender Aktualität (je nach ethischem Standpunkt) erscheinen und noch immer die staatlich-biopolitisch-ärztlichen Utopien antreiben: (i) der „Plan zur Beeinflussung des Geschlechts“ (S. 531), (ii) die Problematik der „rationellen Züchtung“ (ebd.) eines neuen Menschen, den aktiv die Nazis zur Niederschrift der Bloch’schen Überlegungen ergriffen hatten und damit der historisch wesentlich älteren Idee der Eugenik eine menschenverachtenden Höhepunkt verschafften und (iii) der „Kampf gegen das Alter“ (S. 533), dessen Ansätzen, Versuchen und (ersten) Erfolgen sich Bloch am ausführlichsten in diesem Kapitel widmet (S. 533-536).
Geschlechtsbeeinflussung:
Hier meint Ernst Bloch den patriarchalen Wunsch, „mehr Knaben als Mädchen“ zu gebären, um „männliche Stammhalter für Müller und Schulze ihn oben (S. 531) zu bekommen.
Ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist, weil die „Mädchen“ so begehrt würden, dass sie „aus dem Wechsel ihrer Geschlechtsteile“ (S. 531) gar nicht herauskämen.
Die chinesische Praxis der Ein – Kind – Familie indes zeigte, dass eine solche Politik durchaus möglich ist, wenn es auch nicht das Ziel war, mit dieser Politik nur die Gebote von Jungen zu befördern. In Wechselwirkung dieser Politik mit der strukturell – patriarchalischen Kultur in China war es jedoch genau dieses Ergebnis, welches dann erheblich demographische Probleme und Nebenfolgen zeitigte (Joas 2021). Daher ist die chinesische Familien- oder besser: Biopolitik mittlerweile von dieser Prämisse und Politikmaßnahme abgerückt.
Die heutige reproduktive Medizin ist weiter, als Ernst Bloch s sich jemals vorstellen konnte. Sie kann nicht nur einen natürlich vorbehalten Kinderwunsch zur Realität werden lassen, sondern sogar vorgeburtlich das Geschlecht des Kindes feststellen.
Mehr noch: es ist möglich, vorgeburtlich, mit der so genannten Präimplantationstechnik, über mögliche erbliche, in der Zukunft erst auftretende, Erkrankungen und Erkrankungswahrscheinlichkeiten aufzuklären (und entsprechend abtreibend zu handeln; die aktive Beeinflussung der fötalen Physiologie, von der Genetik ganz zu schweigen, ist immer noch (Gott sei dank?!) begrenzt: siehe aber die Möglichkeiten des (theoretischen) Missbrauchs der sog. „Stammzellentherapie“). Hier ist dann der Übergang zur liberalen Eugenik gegeben (siehe den nächsten Abschnitt über die „rationelle Züchtung“), der schwierige und durchaus problematische ethische und gesellschaftspolitische Fragen aufwirft (Habermas 2001; Bogner 2004; s.a. den Real-Dystopie-Roman „Helix“ – Sie werden uns ersetzen“ von Marc Elsberg [2016]).
Schließlich beinhaltet der Aspekt der Geschlechtsbeeinflussung heutzutage noch die Möglichkeit, nachgeburtlich (und zwar praktisch das ganze Leben lang) das biologische Geschlecht mittels der so genannten Techo-Gender-Medizin zu verändern (wenn auch nur gegrenzt, insofern die Gebärfähigkeit zwar ausgeschaltet, aber nicht übertragbar ist). Die technischen Möglichkeiten der Medizin zur Beeinflussung physiologischer und auch genetischer Prozesse der biologischen Geschlechtsmerkmale sind weitaus größer als Ernst Bloch es seit der Zeit seiner Niederschrift des „Prinzips Hoffnung“ denken konnte (1938-1947 id USA). Daher ist die ethische Schlüsselfrage an seine konzeptive Idee zu richten, ob seine progressive Sichtweise auf die realen Utopie in der Medizin tatsächlich seine auf die Zukunft gerichtete optimistische Utopie-Ethik begründen können oder ob nicht eine weitaus kritische Betrachtung medizinisch – technologischer Innovationen im Zeitalter invasiver Biotechnologie nötig ist (s. Jonas 1973, 1979). Doch dabei darf nicht übersehen werden, dass Ernst Bloch durchaus die Fallstricke, Verbindungen und Fehlentwicklungen einer technisierten Medizin gesehen hat, wie er es vor allem im folgenden Abschnitt beschreibt. Sein Diskursbeitrag bleibt dialektisch geöffnet, ohne unter normativer Beliebigkeit zu zerfallen, auch wenn seine gesellschaftliche Vision, der Realsozialismus nicht mehr unter uns ist; mehr noch: selbst nicht unproblematisch gewesen ist – doch eine solche kritische Reflexion war zu seiner Zeit und vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise und ihrer Wirklungen sowie besonders der nationalsozialistischen Weltkriegs- und Vernichtungspolitik nicht Bestandteil der (retrospektiv verständlichen) intellektuellen Begeisterung für die „Sowjetunion“ (s. Deppe 1999; s.a. Hobsbawm 1994).
Rationelle Züchtung
Dieser Abschnitt handelt von den herrschaftlichen und menschenverachtenden Zielen und Plänen der rationellen Züchtung der „Nazis“ und des „gehemmten Bürgertums“ (S. 532), mithin auch des „Adels“ (ebd.), die auf gesellschaftliche Herrschaftsumstände zurückgeführt werden können, und vom Spannungsverhältnis, mit modernen Worten ausgedrückt, zwischen der Bedeutung der Umwelt und der Anlage hinsichtlich der Leiblichkeit, der Krankheit und des (sozialen) Genies. Wobei der Punktsieger und das gesellschaftspolitische Primat eindeutig zunächst die Sozialmedizin ist, auch wenn Bloch nicht kategorisch ausschließt, den „Weg organischer Züchtung“ (S. 533) zu beschreiten. Aber zunächst muss erst die „züchtende Gesellschaft […] gezüchtet werden, damit der neue menschliche Mehrwert nicht nach den Anforderungen der Menschenfresser bestimmt wird.“ (S. 533) Wie ist das möglich? Ernst Bloch droht recht materialistisch: der Kapitalismus (und seine herrschaftlichen Ungleichheiten) gehört abgeschafft (S. 532).
Die Übertragung der Gesetze der Vererbung durch Mendel auf den Menschen führt zu skurillen Erwartungen an die Beeinflussung von „Keimzellen“ (S. 531) vor der Geburt an und das Überleben der geborenen Menschen, welches die Nazis massenhaft im „Mord“ (S. 532) beendeten. Die nationalsozialistische Eugenik vernichtete in böser Manier von ihr ideologisch gehasstes Leben und ein „Beethoven, der Sohn eines unheilbaren Trinkers, wäre nach ihr nie geboren worden“ (ebd.). Selbst der Adel versuchte das Blut rein zu halten und praktizierte doch nur Inzucht. Was den Adel gewissermaßen adelte, war nicht das Blut, sondern der Standeskodex, „der ihm Verpflichtung und Halt gab“,wenn auch „primär durch die gute Kinderstube“ und nicht durch „Vererbung“ (S. 532).
Der Wahn der „rationellen Züchtung“ ist folglich auf Sand gebaut: „Die Blutmischung, welche große Begabung macht, liegt also noch zu sehr im Dunkeln, um sie mit einiger Aussicht physiologisch zu befördern und zu ermuntern.“ (S. 533)
Kehrt der Wahn heute wieder? Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms führt nicht nur zur Wiederbelebung physiologischer Wunder Maßnahmen, sondern in manchen Ecken der Medizin zur Wiederkehr rassifizierter Diskurse. So sollte man nicht vergessen, dass der maßgebliche Genetiker dieses Programms ein ausgesprochen Rassist gewesen ist. Doch das Urteil seriöser Humangenetiker ist eindeutig. Weder gibt es genetifizierte „Rassen“, noch determiniert die Genetik irgendetwas (bis auf sehr seltene Krankheitsmuster): es ist stets ein Dialog und eine Dialektik von Umwelt und genetischer Anlage. Wahrscheinlichkeiten, nicht Determination beherrscht die Medizin.
Die Sozialmedizin, die „soziale Hygiene“, von der Bloch spricht, ist der dominante Faktor humanen Verhaltens und von Ursachen von Erkrankungen, wie man heute sagen würde: „Die Beherrschung des individuellen – biologischen Habitus und die Abschaffung seiner als eines ‚Schicksals‘ sind gewiss ein Ziel, doch erst wird diese Planung die wirklichen Slums niederreißen, bevor sie den Slum des schwächlichen Leibs nahetritt.“ (S. 533)
Mit anderen Worten: Weder das Verhalten, noch die Gene des Einzelnen sind maßgeblich für humane Charakterentwicklungen wie auch Erkrankungen und umgekehrt Gesundheit, sondern die gesellschaftlichen Bedingungen. Mit dieser These bewegt sich Bloch auf der Grundlage sicherer gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnis. Die bürgerliche Übersteigerung des: sorge für dich selbst! kann für alle nur gedeihen in einer Gesellschaft, die weniger (vertikale) Ungleichheiten zulässt. Das ist ein gesundheitswissenschaftliches Gesetz, das jedoch selten in der tatsächlichen Gesundheitspolitik berücksichtigt wird, obwohl es allenthalben als solches – in Sonntagsreden zumeist – anerkannt ist. Für Bloch besteht die Grundlage dieser ansetzenden Gesundheitsförderung in einer Gesellschaft, die den Kapitalismus bzw. die kapitalistische Produktionsweise hinter sich gelassen hat.
Der Kampf gegen das Alter
Dies ist der längste Abschnitt in diesem Unterkapitel, zudem der detaillierteste, aber auch – in Preisung des korrekten bzw. humanen Umgangs mit dem Alter in der Sowjetunion seiner Zeit – wohl auch der kontroverseste.
Zunächst konstatiert Bloch, dass der Kampf gegen das Alter früh anfange, bei Frauen (wohl Kultur bedingt betrachtet) besonders früh, aber dass dieser Kampf im Vergleich mit anderen Tieren vor allem darin Gründe, dass Verluste von Organen und physischen Teilen bei Menschen im Gegensatz zu zum Beispiel Regenwürmer oder Molchen ein eherner, ewiger Verlust sei. Dieses organische Defizit sei die Eintrittspforte zum Wunschtraum des ewigen Jungseins: „Auf dieses Feld wurde der Wunsch Traum vom Jungbrunnen gelegt, und die Linie darauf zu fand, kurpfuscherrisch oder nicht, dauernd Anpflanzung.“ (S. 534)
Im Folgenden beschreibt Bloch zunächst die verschiedenen Versuche („kurpfuscherrisch oder nicht“), ewiges Leben oder Jungsein zu erlangen. Dabei macht er die Entdeckung, dass die verschiedenen Versuche (Tee, Bett, Atemtechnik oder Atembeherrschung) letztendlich zu Entdeckung der Bedeutung von Keimdrüsen, durch die Chinesen, geführt haben (ebd.). Trotz aller Irrwege jedoch trog die Hoffnung auf die Keimdrüse nicht völlig: es wurden Stoffe gefunden, „welche aus Drüsenorganen selbst ausgezogen werden […und…] Krankheiten aus der Unterfunktion dieser Drüsen wenigstens erfolgreich behandeln“ (ebd.) lassen. Die Erkenntnisse der Medizin fasst er so zusammen: „Alle Krankheiten, die auf Unterfunktion der endokrinen Drüsen beruhen (Hypophyse, neben Schilddrüse, Schilddrüse, Nebennieren, Eierstöcke und anderen), können in der Tat durch Präparate aus diesen Drüsen behandelt werden.“ (S. 534f.) Insulin nicht zu vergessen.
Nur gegen das Alter wurde – zunächst – keine Drüse identifiziert. Erst später entwickelten sich „Träume um die Thymusdrüse“ (S. 535). Als Wachstumsdrüse, die sich im Verlauf der Pubertät aufbraucht, wurde danach gestrebt, sie bis ins hohe Alter aufrecht zu erhalten. Doch umsonst: „Der utopische Apfel der Verjüngung hängt trotzdem noch in ziemlicher Ferne, und – was Prüfung auf Herz und Nieren angeht – bleibt das Alter fast wie zu Großvaters Zeit auch. Geändert hat sich die Weise, es zu nehmen, nämlich nicht mehr hypochondrisch, nicht mehr übertrieben.“ (Ebd.)
Nur in der Sowjetunion, so Bloch weiter, werde gegen die „herabwertenden Wirkungen des Alters“ (ebd.) wirklich gekämpft, in dem es „zu einer sozial besonders nützlichen Periode der Arbeit“ (Metschnikow, zit.n. Bloch 1985: 535) geformt werde. Hier durch verändere der Sozialismus die Bedeutung des Alters, dass in früheren Gesellschaften und auch im Kapitalismus seiner Zeit vor allem eine „überflüssige Belastung für die Gemeinschaft“ (ebd.) gewesen sei.
Diese positive Sichtweise auf den Umgang mit dem Alter im Realsozialismus wirft freilich die Frage auf, ob es sich hier nicht nur um eine Variante des von Stephan Lessenich (2004, 2008, 2009) beklagten „Ökonomismus oder Produktivismus zum Wohlfühlen“ handelt, das den ethischen Anspruch auf menschliche Autonomie und Individualität des einzelnen Subjekts nach seinem gesellschaftlichen Nutzen bewertet und maßgeblicher Aspekt einer um sich greifenden „Ökonomisierung des Sozialen“ (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000) und „Ökonomisierung der Sozialpolitik“ (Evers/Heinze 2008) im neoliberalen Zeitalter geworden ist (Mosebach 2011; Lessenich 2012).
Dieser kritische Gedanke an die positive Bewertung des gesellschaftlichen Nutzens des Alters kann hier nicht weiter ausgeführt werden, sollte jedoch vor dem Hintergrund der Perversionen des sozialistischen Gedankens im weiteren Verlauf des Stalinismus und des Zusammenbruch des Realsozialismus 50 Jahre nach dem hier niedergeschriebenen Gedanken Ernst Blochs doch zu denken geben. Oder anders formuliert: kehrt in der Ideologie des „aktiven Alterns“ (Lessenich 2008) nicht dieser von Bloch irritierenderweise ‚gefeierte‘ (KM) „Ökonomismus zum Wohlfühlen“ in kapialistischem Mantel zurück? Ist das dann noch progressiv? Oder einfach nur Ideologie ohne jeden Realitätsgehalt? Ich denke Letzteres, denn nicht jedes Alter, nicht jeder Alte und jede Alte, zählt. Es scheint indes ein kurzer Weg zu sein von der sowjetischen „Rettung“ des Alters aus seiner gesellschaftlichen Belastungsidentifikation zur sozialdemokratischen Strategie des aktiv Alterns – das gut gemeint, aber als Ideologie nicht mehr ist als ein alternativer „Produktivismus zum Wohlfühlen“ (Lessenich 2004; siehe Stichpunkte zu einem sinnvollen Umgang mit dem „Alter“ im demographischen Übergang: Scherrer et al. 2000: 92ff.).
Ernst Bloch resümiert seine Reflexion über das Alter als Grenze indes mit den zutreffenden Worten: „Das Leben über seine bisherigen Grenzen hinaus zu treiben, über die für unsere Fähigkeiten, ungetanen Arbeiten, Zweckreihen viel zu engen, das ist der Wunsch, der den nach Heilung einschließt und ersichtlich überbietet.“ (S. 536)
Zögerung und Ziel im wirklichen leiblichen Umbau
In diesem Unterkapitel, dem zweitlängsten und differenziert-konkretesten hinsichtlich gesundheitssoziologischer Fragestellungen, werden die maßgeblichen gesundheitswissenschaftlichen, oder besser: medizinsoziologischen Begriffe erörtert: der Kranke, der (praktische) Arzt und der Begriff des Krankseins bzw. der Gesundheit. Die Hauptthese ist: Die „eingeborene ärztliche[n] Utopie“ ist: der „schließliche[n] Umbau des Leibs“ (S. 538) des Kranken. Diese praktische Utopie hält sich fern von jenen weitschweifigen Utopien, die vorher genannt und von Bloch als gesellschaftsweite, ja geradezu anthropologische Utopien betrachtet wurden, namentlich die rationelle Züchtung, der Kampf gegen das Alter oder die Beeinflussung des Geschlechts.
Die praktisch-ärztliche Utopie des Umbaus des Leibes an den Grenzen zur Abschaffung des Tods: Zögerung und Ziel bis zur industrialisierten Medizin
Die im Unterkapitel-Titel genannte Zögerung im wirklichen leiblichen Umbau durch den praktischen Arzt leitet sich, Bloch zufolge, aus der „Herkunft der europäischen Heilkunde“ (S. 537) her, nämliche der Stoa, mithin also Galen. Bekanntlich ist demnach Gesundheit „die rechte Mischung der vier Hauptsäfte des Körpers (Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim), Krankheit dagegen Störung dieses Gleichgewichts.“ (S. 537) Ruhend in der antiken Naturphilosophie, war und ist es das Prinzip der stoischen Medizin, auf die Natur zu vertrauen: „Ein guter Arzt folgt der Natur, unterstützt sie, widerspricht ihr niemals: das ist stoische Erbe.“ (S. 538)
Ab der Neuzeit indes, genauer ab dem 18. Jahrhundert, ändert sich der „ärztliche Blick“ (Foucault 1969). Die Intervention des Arztes in den menschlichen Leib des Kranken, beliebt sind hier „Klystiere“ (S. 538), bringt den empirisch mutigen, sogar „utopistisch übermütigen“ (ebd.) Arzt auf die Bühne. Das Ziel der ärztlichen, eingeborenen Utopie, der Umbau des Leibes betritt die Bühne. Zunächst ist es sogar die Naturheilkunde, die jedoch die schlechteste utopische Idee voran bringt, dass unwissende „wishful thinking“ (ebd.).
Der „empirische Arzt“ bleibt an Erkenntnisse, Wissen gebunden; der erfolgreiche leibliche Umbau am Kranken ist von dessen Bedingungen abhängig. Ernst-Bloch-Zentrum ist sich sicher: „Verantwortung und stoisches Erbe hielten den Anschluss ans objektiv Mögliche; anders als oft bei der Eugenik und dem Kampf gegen das Alter.“(S. 539)
Dennoch schwingt im Hintergrund der Tätigkeit von praktischen Ärzten, d.h. wirklich tätigen Ärzten „am Kranken“ (KM), Eine weitergehende Utopie, ein atemberaubender Plan mit. Ernst Bloch schreibt: „Der Satz darf letzthin gewagt werden: gerade weil der Arzt, auch am einzelnen Krankenbett, einen fast wahnwitzigen utopischen Plan vor sich latent hat, weicht er ihm scheinbar aus. Dieser endgültige Plan, der letzte medizinische Wunschtraum, ist nichts Geringeres als [die, KM] Abschaffung des Tods.“ (S. 539)
Verantwortung und stoisches Erbe verzögern demnach die Dynamik und Intensität des ärztlichen besorgten leiblichen Umbaus des Patienten. Vor dem Hintergrund der nach dem zweiten Weltkrieg begonnen Explosion medizinischer Errungenschaften, stellt sich freilich die Frage, ob sich nicht diese Zurückhaltung verändert hat. Hinzuweisen ist auf die Kritik der Gesundheitsbewegung in den 1970er und 1980er Jahren an einer industrialisierten Medizin, die scheinbar oder möglicherweise tatsächlich jedes stoische Erbe hinter sich gelassen hat und sich symbolisch in eine Medikalisierungskritik an der Medizin (Illich 1984) verdichtet hat (Mosebach 2010; Mosebach/Walter 2021).
Desweiteren kann Ernst Bloch nicht antizipiert haben, dass sich die zunächst wohlfahrtsstaatliche ausgebreitete industrialisierte Medizin im Zuge der „neoliberalen Konterrevolution“ (Altvater 1981) in eine globale, mit Wachstumshoffnungen behängte (Nefiodov 2006) und hochgradig kommerzialisierte Industrie- und Dienstleistungsbranche verwandelt hat (Tritter et al. 2010; Mosebach 2010). Wenn es ein Prinzip in der kapitalistischen Produktionsweise gibt, ist es das der profitgetriebenen Logik der Ausweitung von produzierten Waren und Dienstleistungen zum Zweck der Kapitalverwertung (G-G‘), die – angewandt auf medizinische Leistungen – unzweifelhaft zu einer Ausweitung des „leiblichen Umbaus“ führen; nicht immer zum Nutzen der Patienten, wie schon lange bekannt, aber kaum noch erforscht wird (s. z.B. SVR-KAiG 200/2001).
Mit anderen Worten: meines Erachtens kann von einer Zurückhaltung der Medizin, wie sie noch Ernst Bloch identifiziert hat, unter kapitalistischen Bedingungen nicht mehr gesprochen werden. Das schließt nicht aus, dass es zu Unterversorgung kommt, wenn sich die Profitlogik bei der Bereitstellung von Leistungen nicht rentiert (Kühn 1993; 2004). Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ist schlecht für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und die Heilkunst selbst (Deppe 2011; Maio 2014).
Abhilfe schaffen kann hier – wenn überhaupt – nur eine strikt angewandte und neutral umzusetzende evidenzbasierte Medizin und Versorgungsforschung. Diese ist zwar leicht zu fordern, aber im allgemeinen Interessenskampf im Gesundheitswesen um „Lebenschancen von Organisationen“ (Alber 1992) nur schwierig umzusetzen (vgl. aber: Schmacke 2005; Gerhardus et al. 2010; Gerlinger/Rosenbrock 2024; Pfaff et al. 2024). Ein systematisches Problem ist in diesem Zusammenhang ist, dass sich die Kämpfe um die Verteilung von Einfluss und Geldmittel im Gesundheitssystem mittlerweile im Rahmen des Diskurses jener hier als Lösung genannten evidenzbasierten Medizin und Versorgungsforschung bewegen. Folglich ist es nicht mehr so einfach möglich (wie beim Aufkommen der EbM-Bewegung), wissenschaftliche Evidenz von der Verfolgung ökonomischer Interessen zu trennen, weil die Letzteren in der Sprache der wissenschaftliche Evidenz formuliert und damit tendenziell eskamotiert werden (können) (vgl. zu diesem wissenschaftssoziologischen Grundproblem zur wünschenswerten Autonomie des Wisssenschaftlichen und des Schutzes korrumpierender politischer und wirtschaftlicher Intrusion und Vernetzung: Weingart 2011). Es existieren hier unterschiedliche, konfliktive, Rationalitäten im Gesundheitswesen (Vogd 2011; Vogd et al. 2019).
Der Gesundheitsbegriff: eine historisch-gesellschaftliche Kategorie
Gesundheit ist, das macht Ernst Bloch unmissverständlich deutlich, ein historisch wie gesellschaftlich relativer Begriff. „Gesundheit ist überhaupt nicht nur ein medizinischer, sondern überwiegend ein gesellschaftlicher Begriff.“ (S. 539) Gesundheit ist folglich in unterschiedlichen Gesellschaften Unterschiedliches: „Gesundheit ist in der kapitalistischen Gesellschaft Erwerbsfähigkeit, unter Griechen war sie Genussfähigkeit, im Mittelalter Glaubensfähigkeit.“ (S. 540)
Folglich ist die Rolle des Arztes ebenso relativ in Bezug auf gesellschaftliche Kontext. „Gesundheit wiederherstellen, heißt in Wahrheit: den kranken zu jener Art von Gesundheit bringen, die in der jeweiligen Gesellschaft die jeweils anerkannt ist, ja in der Gesellschaft selbst erst gebildet wurde. Also sind selbst für die bloße Absicht der Wiederherstellung die Ziele des Wieder wechselnd, mehr: Sie werden selber erst von der jeweiligen Gesellschaft als ‚Norm‘ gesetzt.“ (S. 539)
Diese Aussagen von Ernst Bloch Treffen sich mit dem soziologischen Gesundheitsbegriff, selbst eines Talcott Parsons, der Gesundheit dadurch definiert, dass man gesellschaftliche Rollen übernehmen kann, für die man sozialisiert worden ist. Ebenso geht der Blog Gesundheits Begriff konform mit jener neuen Forschungsrichtung der medizinischen Anthropologie, die aufzeigt, dass Bedeutungsinhalte von Krankheit und Gesundheit ebenso wie die ärztliche Praxis nicht nur historisch wandelbar sind, sondern auch in kulturelle Bedeutungsysteme Eingebettet werden (Herzberg; Duden, Armstrong).
Nach der Skizze der Gesundheitsverständnisse von der Antike bis zum Mittelalter schlussfolgert Ernst Bloch daher konsequent: „Eine vorgegebene, gleich bleibende Gesundheit ist derart nirgends vorhanden; es sei denn in der allgemein – materialistischen und nur darin ewig jungen Formel: Auf einem vollen Bauch sitzt ein fröhlich Haupt. Doch jeder weitergehende Text von mens sana in corpore sano ist keine Erfahrung, sondern ein Ideal, und zwar ein in der jeweiligen Gesellschaft verschiedenes. Also gibt der Arzt jeder jeweiligen Gesellschaft, statt uranfänglich allgemeine Gesundheit wiederherzustellen, dem Kranken viel mehr eine hinzu. Er baut eben jedes Normale wieder auf, das sozial jemals im Schwange ist, und: er kann es wieder aufbauen, weil eben auch der Leib des Menschen im Stande ist, sich funktionell zu verändern, gegebenenfalls zu verbessern.“ (S. 540f.)
Was damit offenbleibt, ist freilich die Frage, ob es etwas allgemeines gibt, dass Gesundheit ausmacht und an dessen Erziehung der Arzt Anteil hat beziehungsweise sich ab arbeitet? Auf einer abstrakten Ebene gibt es das. Es ist das, was ernst Bloch als organischen Wunschtraum (des Kranken, des Arztes) bezeichnet, einen Leib zu haben, „auf dem nur Lust, nicht Schmerz serviert wird und dessen Alter nicht Hinfälligkeit, als Schicksal, ist. Es ist also dieser Kampf gegen das Schicksal, der medizinische und soziale Utopie ihn trotz allem verbindet.“ (S. 541; Hervorhebung: i.O.)
Real-utopisches Handeln als sozialphilosophische Kategorie findet somit auch im Bereich der Gesundheit, der Zurückdrängung von Schmerz und im Wunsch nach dem verdrängen von Alter, statt. Aber wie es für soziales Handeln bekannt ist, bleibt dieses real-utopische Handeln an die Gesellschaft und ihre historische Wandelbarkeit sowie die kulturelle Unterschiedlichkeit bestehender Gesellschaften im Weltzusammenhang gebunden. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine neue Form gesundheitlichen Handelns eingefordert beziehungsweise verfolgt wird: die gesundheitliche Sorge um sich selbst, die permanente und erwünschte Prävention von Krankheit und Risiken zur Sicherung der „Erwerbsfähigkeit“ (neudeutsch: Employability), mit einem Wort: New Public Health (Petersen/Lupton 1992; Brunnett 2009; Lupton 2010; Mosebach 2010; Hehlmann/Schmidt-Semisch/Schorb 2018; Mosebach/Walter 2021)
Malthus, Geburtenziffer, Nahrung: das Versagen einer reduktionistischen Individualmedizin
In diesem kurzen Kapitel erhebt Ernst Bloch die schärfster Kritik an der, mit heutigen begriffen, Individualmedizin. Er stellt sie in den Kontext und die Tradition der Malthus’schen Bevölkerungstheorie. Diese behauptete bekanntermaßen, dass der Grund des Elends der Massen im entstehenden Kapitalismus im Widerspruch begründet sei zwischen „dem grenzenlosen streben des Menschen nach Fortpflanzung und der beschränkten Zunahme der Nahrungsmittel.“ (S. 542)
Ernst Bloch weißt diese Identifikation der Ursachen das Massenelends zurück. Es ist nicht die „proletarische Geilheit“ (ebd.), die das „soziale Elend“ (ebd.) produziert, sondern die kapitalistische Produktionsweise. Hier bezieht sich Ernst Bloch eindeutig auf die Kapitalismusanalyse von Karl Marx, der zufolge der Prozess der kapitalistischen Akkumulation jene überschüssige Bevölkerung hervorruft, die Malthus und seine Konsorten selbstverschuldet zu Ursache ihres eigenen Elends machen.
Bloch bezeichnet die Kriegshetzer im „Zeitalter der Katastrophen“ (Hobsbawm 1994) der beiden Weltkriege als Neo-Malthusianer, die „den Krieg“ rechfertigen, indem die „Verschrottung der ‚überzähligen‘ Arbeitslosen, die faschistische Ausrottung ganzer Völker, und zugleich [… all] jene[r] Proletarier“ gefeiert werde, „denen das Dasein, nach dem numerus clausus des Profitinteresses an ihnen“ (alle Zitate: S. 543) verwehrt werde.
Doch – wie bereits angedeutet – teilt die Individualmedizin, wenn nicht die Menschen verachteten Praktiken, so doch die methodologische Grundlage des Malthus’schen Denkens: „Das Malthussche, als abgelenkte Diagnose auf unzureichende, gesellschaftlich isolierte Ursachen, ist daher nicht nur Überbevölkerungslehre und darauf beschränkt. Denn auch in Kreisen, die von Klopffechterei nichts wissen oder wissen wollen, ersetzt oder verdrängt der lediglich medizinische Rückgriff jenen auf die sozialen Ursachen des Elends.“ (S. 543) Ernst Bloch formuliert hier eine Kritik an einem medizinischen Reduktionismus hinsichtlich der Erklärung sozialen und gesundheitlichen Elends, welche zu seiner Zeit und auch heute noch kumulativ zusammenhängen.
In einer Formulierung, die an die literarische Figur des Sherlock Holmes erinnert, der nach seinem Erzähler (d.h. dem kleinbürgerlichen John Watson bzw. seinem Erfinder: Sir Arthur Conan Doyle) bekanntlich aus einem einzelnen Morgenpantoffel die gesamte Geschichte des Orients ableiten konnte, hinterfragt Bloch jenen „ahnungslose[n] Schmalblick, der aus einem Tropfen Blut sozusagen, ins Laboratorium geschickt, die ganze Krankheit der Menschen zu erkennen glaubt.“ (S. 543f.) Der methodologische Sündenfall besteht im folgenden: „vom lebendigen ganzen Leidträger wird weg gesehen, besonders aber von den Umständen, worin er sich befindet.“ (S. 544) Die Folgen für die medizinische Erkenntnis sind gravierend: „von daher die Übersetzung der Bazillen, als die einzigen Seuchenerreger; die Mikrobe verdeckte vor allem andere Begleiterscheinungen der Krankheit, schlechtes Milieu und dergleichen; so enthob sie von der Pflicht, auch dort die Ursachen zu suchen.“ (Ebd.) Die Schwindsucht zu überwinden, so schlussfolgert Ernst Bloch in über Einstimmung mit modernen sozial eprimo logischen Erkenntnissen, bedeutet die Armut zu bekämpfen, also jenen sozialen Zustand, der eine so hohe Empfänglichkeit für die Schwindsucht hatte. Eine reduktionistische individualmedizin, selbst präventiver Art, bekämpft die Armen und nicht die Armut. Die Folgen eines sozial inkompetenten oder schlicht unverantwortlichen Arzt sind gravierend: „Einseitig ärztlicher Abtreibung der übel ist dergestalt oft nur ein absichtlich oder unabsichtlich gewähltes Mittel, um die wirklichen Übel nicht beheben zu müssen.“ (S. 544) Und noch schärfer: „so bezeichnet das gesamte Malthus Wesen, auch abgesehen von dem Mann selbst und seiner Lehre, ein ganzes Feld der Verdrängung. Bloße mechanistische Pflasterkasten, ohne Primat des sozialen Milieus und ohne Plan seiner Veränderung, ohne Pawlow und Kenntnis des ganzen Menschen als eines cerebral – sozialgesteuerten Wesens, – das verhindert die Zusammenarbeit von Arzt und rote Fahne, unter voran tritt den Letzteren.“ (S. 544)
Die Lösung des sozialen Elend, dass mit Krankheit und frühzeitigen Tod ein hergeht (wie bereits Friedrich Engels in seinem lesenswert Bericht über die Lage der arbeitenden Klassen in England feststellte), sieht Ernst Bloch in einer Umgestaltung der kapitalistischen Produktionsweise und einer bedingten Geburtenkontrolle. Er schreibt abschließend: „Solange es nämlich kapitalistische Gesellschaft gibt und das Leben in ihr so prekär ist, dass sie dergleichen Einschränkung [d.h. Geburtenkontrolle, KM] oder Abtreibung braucht. Solange sie in dem Zustand bleibt, den sie heute hat: nämlich ihre Sklaven nicht mehr füttern zu können. Raum für alle hat die Erde, oder sie hätte ihn, wenn sie mit der Macht der Bedarfsdeckung statt mit der Bedarfsdeckung der Macht verwaltet wäre.“ (S. 544)
Die Sorge des Arztes
In diesem letzten Unterkapitel des zentralen 35. Kapitels beschreibt Bloch nichts weniger als eine ärztliche und medizinische Utopie für die nachkapitalistische Gesellschaft. Im direkten Anschluss an die Strategie der „Macht der Bedarfsdeckung“ (S. 544) schlussfolgerte er: „Dann erst finge auch die ärztliche Arbeit wirklich sauber an.“ (S. 545)
Doch hierzu müsse, nochmals, die Gesellschaft jene klinische Aufmerksamkeit und Planung erfahren, die sonst im Kapitalismus nur der individuelle Einzelne erfährt. Das könnte der Arzt auch selbst erfahren, wann immer er Slums betritt. Und auch während der Behandlung spricht alles seinem medizinischen Gewissen Hohn: der arme Teufel mit kranker Niere fährt, um seinen Verdienst nicht zu verlieren, auf dem ratternden Lastwagen, die Zähne vor Schmerz zusammen gebissen, während er Reiche unter der Steppdecke ruht.“ (S. 545) Der „Kapitalismus ist ungesund – sogar für die Kapitalisten.“ (Ebd.)
Was wäre das Ziel einer nachkapitalistischen Medizin, einer nachkapitalistischen ärztlichen Praxis? Bloch zitiert einen Kinderarzt, der einen Gemeinplatz formuliert, aus dem sich gewisse nicht bürgerliche Forderungen aufstellen diesen: „Kurieren, curare, Sorge für jemanden tragen, heißt vermeiden, dass seine Gesundheit überhaupt gestört wird. Ist dies trotzdem geschehen, so soll die cura des Arztes darauf gerichtet sein, den erkrankten in Verhältnisse zu bringen, die für ihn möglichst günstige sind.“ (S. 545) Ein schönes Ziel, so meint Bloch, aber erst im Sozialismus erreichbar.
Er geht mit seinen Visionen von einer sozialistischen oder sogar marxistische Medizin noch weiter. Ist erst einmal die krankmachende kapitalistische Produktionsweise überwunden, so kann auch „in das Vorbedingende“ (Hervorhebung: i.O.) eingegriffen werden: „Das ist ihr da sein im Mutterleib, weiter der Ihnen von daher mitgegeben körperliche Zustand.“ (S. 545) Das Ziel einer solchen, gewissermaßen progressiven, Eugenik wäre, den organischen Start nicht viel ungehinderter zu machen als den sozialen. Das hieße konkret, „den Leib vor der Geburt bereits in seinen Anlagen richten zu wollen“, um ihm „nach der Geburt bewusst, gegebenenfalls verändert, vital fortzuformen, von der beherrschten inneren Sekretion her oder aus noch unbekannten Bindekräften.“ (S. 546)
Doch die „sichtbarste Hoffnung“ einer sozialistischen Gesellschaft „bleibt bei alldem der zentral steuernde Einfluss des Lebens in einer gesund gewordenen Gesellschaft auf die Krankheiten des Geboren – und Erwachsenseins selber, vorzüglich auf deren Verhütung, und auf die Lebensdauer.“ (S. 546)
Bloch Weiß selbst, dass es ein weiter Weg bis dorthin ist. Er ist überzeugt, dass im kapitalistischen Betrieb dies nicht erreichbar ist, „denn Gesundheit ist etwas, das genossen, nicht verbraucht werden soll.“ Und im Kapitalismus wird Gesundheit als materieller Bestandteil der leiblichen Arbeitskraft verbraucht (Engels, Polanyi, Mosebach 2017).
Im letzten Absatz des 35. Kapitels fasst Bloch nochmals die Quintessenz der Bedeutung von Gesundheit in Prinzip Hoffnung markant zusammen: „Schmerzloses, langes, bis ins hohe Alter, bis in einen lebenssatten Tod aufsteigendes Lebens steht aus, wurde stets geplant. Wie neugeboren: das meinen die Grundrisse einer besseren Welt, was den Leib angeht. Die Menschen haben aber keinen aufrechten Gang, wenn das gesellschaftliche Leben selber noch schief liegt.“ (S. 546; Hervorhebung: i.O.)
UND: was bleibt als (aktualisierte) Kritik an Bloch’schen Thesen?
Ernst Bloch heute: immer noch Kapitalismus?
Seit der Niederschrift von „Das Prinzip Hoffnung“ (1938-1947, durchgesehen 1959) hat sich der Kapitalismus gewandelt. In den Sozialwissenschaften spricht man in Bezug auf die Länder des „atlantischen Fordismus“ (van der Pijl 1984, Jessop 2002) vom so genannten Wohlfahrtskapitalismus. Dieser ist ein Kind des Zweiten Weltkriegs und der nach dem Zweiten Weltkrieg bestehenden Systemkonkurrenz von Kapitalismus und Kommunismus (oder auch: Realsozialismus). Dem britisch-österreichischen Historiker Eric J. Hobsbawm wird das Wort zugeschrieben, dass der Kommunismus für die Menschen in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten nicht immer förderlich war, aber dass er für die Zugeständnisse des Kapitals, der Unternehmer, an die Gewerkschaftsbewegung und sozialdemokratische Linke in West-Europa von nicht unterschätzen der Bedeutung gewesen ist. Ohne die Drohung des Kommunismus aus dem Osten, kein Klassen Kompromiss im Westen, und damit auch kein Ausbau des Wohlfahrtsstaates bis zu seiner Krise in den 1970erJahren; auch wenn die Sozialstaaten höchst unterschiedlich aufgestellt waren (Esping-Andersen 1990).
Seitdem gibt es eine globale „neoliberale Konterrevolution“ (Altvater 1981) oder auch einen „Wiederaufstieg des Kapitals“ (Dumeníl/Levy 2004), die beziehungsweise der dem Ausbau des Wohlfahrtstaates ein Ende gesetzt hat. Stichworte sind: finanzielle Austerität und wohlfahrtsstaatlicher Umbau und Rückzug (Pierson 1994; Blyth 2002, 2013; Hay/Wincott 2012; Streeck 2015, 2020) und wettbewerbsbasierte Kostendämpfung im Gesundheitswesen (Deppe 1987; Gerlinger 2002; Gerlinger/Mosebach 2009; Mosebach/Schwartz 2023). Der mit der Krise der 1970er und 1980 Jahre entstandene flexible Kapitalismus (Bieling/Deppe 2001; Lessenich 2009) näherte sich, nicht vom Niveau, aber von der Strategie her (Deregulierung, Liberalisierung und Flexibilisierung durch Globalisierung, vgl. Hirsch 1995) den Prinzipien der kapitalistischen Produktionsweise an, von der Ernst Bloch in mitten des Zweiten Weltkriegs gesprochen hatte. Die Folge der Arbeitsmarktflexibilisierung ist zum einen die Aufstieg von „Unsicherheitszonen“ in der Arbeitsgesellschaft und der Wiederkehr der Prekarität (Castel 2005) und zum anderen die Kriminalisierung von Menschen in der „neuen Arbeitsgesellschaft“ als staatlich vermitteltem „Lohn der Angst“ (Bourdieu 2007)
Insofern lässt sich die eingehende Frage in Bezug auf die führenden Industrieländer mit einem klaren Jein beantworten (für viele ärmere Länder, die nichtsdestotrotz in den kapitalistischen Weltmarkt einbezogen sind, ist die Antwort zweifellos: ja!). Ja, es ist immer noch Kapitalismus und nein, es besteht eine große wohlfahrtstaatliche Infrastruktur, die in manchen Ländern, nicht allen!, die Gleichsetzung der Bloch’schen Rahmenbedingungen mit den heutigen Kontexten zu verbieten scheint. Allerdings befinden wir uns in einer Zweiten Großen Transformation (Blyth 2002; Dörre et al. 2019), die mit dem Aufstieg der Globalisierung die Wiederkehr und Ausbreitung kapitalistischer Produktionsformen hervorgebracht hat. Wie einst der leider viel zu früh verstorbene Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirrmacher, nach der Finanzkrise von 2007ff bekannte, dass er glaube, dass die politische Linke mit ihrer Kapitalismuskritik und damit Marx recht gehabt hätten (siehe auch: Eagleton 2012). Also: trotz eines zunächst unentschiedenen Jeins zur Frage, ob Ernst Blochs Analyse der Wirkung des Kapitalismus auf die Gesundheit immer noch zutrifft, gilt zu konstatieren, dass der Aufstieg des globalen Neoliberalismus im Allgemeinen und der wettbewerbsbasierten Kostendämfpungspolitik im Gesundheitssystem im Besonderen die Bejahung der Frage mittlerweile zunehmend nahelegen.
Das bedeutet, dass – in der Tendenz, nicht en Detail – die Kritik von Bloch an der Medizin im Kapitalismus und der kapitalistischen Gesellschaft noch immer zutrifft ist. Wenn auch berücksichtigt sein muss, dass das Medizinsystem sich ausgeweitet hat, es einen Paradigmen Wandel in Richtung Prävention und Gesundheitsförderung gibt und die Gesundheit beziehungsweise das Gesundheitswesen mittlerweile sogar als globaler Wachstumsfaktor identifiziert worden ist. Die Kommerzialisierung der Medizin und des Gesundheitswesens, die Veränderung der Krankenversorgung in eine Situation, in der „Gesundheit als Geschäftsmodell“ (Maio 2014) betrachtet wird, war für Ernst Bloch noch jenseits des Denkens und der Erfahrung. Mit der Verwandlung des Patienten in einem Kunden ändert sich jedoch die Grundgrammatik der Kranken – und Gesundheitsversorgung, freilich nicht immer zum Guten (Mosebach 2010; Deppe 2011; Tritter et al. 2011).
Ernst Bloch, die sozialistische Linke und die Eugenik: Aktualisierungsnotwendigkeiten
Der „neue?“ Mensch als Produkt der Korrektur biologischer Defizite durch die Medizin (Eugenik) war unter Sozialisten weit verbreitet (z.B. auch: Salvador Allende); allerdings ist nicht ganz klar, welche Maßnahmen befördert wurden (Bloch spricht von „guten Lebensbedingungen“; S. 532, die eigentlich nicht biomedizinisch, sondern eher sozialmedizinisch begründet sind).
Ethisch aber problematisch, weil es einen (progressiv gemeinten) „Technikutopismus“ gebiert, dem man sehr wohl fundamental-kritisch sehen kann (–> Hans Jonas, 1973, 1979)
In der Folge kann es m.E. keinen „linken“ Eugenik-Diskurs geben: Heute –> Präimplantationsdiagnostik und die Folgen, Wiederkehr einer „liberalen Eugenik“ (Habermas 2001; Bogner 2004)?
Technologisierte Medizin („Medikalisierung“) als Gefahr: Ivan Illich 1976; Bewegung der evidenzbasierten Medizin (Sachs…); sieht Bloch auch so: „Und die Behandlung kann in der Tat nicht nur scherzhafter, sondern gefährlicher, auch länger andauernd sein als die Krankheit selbst.“ (S. 530)
Situation heute: „Ausweitung der Diagnose- und Behandlungszone“ (kommerzialisierte Medikalisierung).
Präventionspolitik, Früherkennungsprogramme und die Gefahr einer kommerzialisierten Präventionsversorgung
Ernst Bloch hat den Wiederaufstieg von Prävention und erst recht die Gesundheits Bewegung gegen die industrialisierte Medizin und für die nicht–medizinische Gesundheitsförderung nicht erlebt. Dennoch war in der Gedanke der Prävention, und vor allem der Primärprävention, zumindest dem Sinn nach nicht fremd. Denn die Idee der sozialen Hygiene beruht auf dem Gedanken, dass „die besonderen Gesundheits Gefährdungen beziehungsweise Gesundheitsgefahren einer nach sozial wissenschaftlichen Parametern definierten Gruppe“ (Labisch/Woelk 1998: 66) zu gewiesen werden können. Das auftreten insbesondere von Infektionskrankheiten, Geschlechtskrankheiten, Alkohol Missbrauch oder Geisteskrankheit in diesem besonderen sozialen Gruppen beschrieben erstmalig die soziale Verteilung von Krankheiten jenseits biologischer oder rein umweltbezogener Faktoren.
Die praktizierte soziale Hygiene war jenseits der Beschreibung jener Problemgruppen in ihrer konkreten praktischen Gesundheitsfürsorge durchaus ambivalent. „Als Interventionsformen der Gesundheitsfürsorge bildeten sich nach und nach die dauernde ärztliche Beobachtung gesundheitsgefährdeter/– gefährdenden Bevölkerungsgruppen, die frühzeitige Feststellung von Krankheitsanlagen und Krankheitsanfängen und schließlich hygienische Aufklärung, Beratung und Erziehung heraus.“ (Ebd.) Ernst Bloch intoniert jedoch eine mehr strukturmarxistische oder, in moderner Diktion, verhältnisorientierte Vorstellung von sozialer Hygiene als die wirkliche Praxis zu Beginn des 20. Jahrhunderts sie verfolgte. Insofern orientiert er sich viel mehr an jener Sozialmedizin, die der bekannte Arzt und Revolutionär der 1848er Revolution, Rudolf Virchow, vertrat, der die Aufhebung von Armut (und damit Ungleichheit) zur Beseitigung von Krankheit und damit verbundenen sozialen Elend einforderte.
Die epidemiologische Transformation (der Aufstieg der chronisch – degenerative Erkrankungen) als hauptsächlichen Ursachen von Mobilität und Brutalität statt ebenfalls erst nach der Niederschrift des Bloch’schen Werkes im Mittelpunkt der Realität. Auch die Forderungen der sich bildenden Mittelklassen im Zuge der Expansion des Wohlfahrt Staates nach einer stärkeren Beteiligung an Entscheidungen über Faktoren von Gesundheit und Krankheit, konnte Ernst Bloch in dieser expressiven Dynamik nicht vorher sehen. Der Aufstieg von Prävention und Gesundheitsförderung seit den 1970er Jahren ist folglich an eine gesellschaftliche Transformation gebunden, die sich anhand eines Zitats aus einem von uns verfassten Aufsatzes wie folgt beschreiben lässt (s. Mosebach/Walter 2021: 108f.):
„Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Niederschlagung des Nationalsozialismus einigten sich Kapital und Arbeit auf eine Wirtschafts- und Sozialordnung, die neben dem privaten Wirtschaftssektor eine gemischte Wirtschaft etablierte, in der ein öffentlicher Unternehmenssektor, ein korporatistischer Sozialstaat und (über-)betriebliche Mitbestimmung realisiert wurden (Simonis 1998; Streeck 1999). Gesundheitspolitik war Sozialpolitik, indem die „Sozialpartner“ (Kapital und Arbeit) maßgeblich an der Politikformulierung des Staates beteiligt waren und die Krankenkassen via Selbstverwaltung steuerten (Korporatismus) (Alber 1992). Prävention und Gesundheitsförderung als systematische Politikansätze zur Verhinderung chronisch-degenerativer Erkrankungen waren de facto kaum vorhanden. Prävention war hauptsächlich auf die Vermeidung und Eindämmung von Infektionen durch öffentlichen Infektionsschutz und individualisierte Sozialmedizin fokussiert (Stöckel und Walter 2002).
Der Aufstieg von Prävention und Gesundheitsförderung seit den 1970er-Jahren verdankt sich daher auch der Krise jenes „Traumes immerwährender Prosperität“ (Lutz 1989), der im „Wirtschaftwunder“ blühte und in der Weltwirtschaftskrise der 1970er-Jahre schließlich zerplatzte. Zugleich ging diese Wirtschaftskrise mit der Restrukturierung der industriellen Arbeiterklasse und dem Aufstieg postmateria- listischer Milieus von Angestellten in neu entstehenden Dienstleistungsbranchen einher (Crouch 1998; Therborn 2000). Diese neue(n) Mittelklasse(n) forderte(n) aufgrund der (demokratischen) Bildungsexpansion zu Beginn der 1970er-Jahre mehr Beteiligung und Mitsprache bei – nicht nur – gesundheitlichen Entscheidungen ein (Moran 1999). Die hiermit einhergehende Individualisierung von Lebens- entwürfen verband sich schnell mit einem neuen (post-) modernen Konsumstil, der durch neue flexible Produktions- methoden von Konsumgütern möglich wurde. Der „alte“ Sozialstaat wurde im Kontext der ökonomischen Globalisierung als zu teuer und unflexibel kritisiert (Hirsch und Roth 1986; Beck et al. 1994).
Der relative Niedergang der industriellen Arbeiterbewegung und die zunehmende Wettbewerbsorientierung neuer Arbeitnehmergruppen im Zuge dieser neoliberalen Moder- nisierungsstrategie führte zu einem Wandel des korporatistischen Gesundheitssystems in Deutschland in Richtung auf ein wettbewerblich ausgerichtetes Gesundheitswesen (Gerlinger 2009; Gerlinger und Mosebach 2009). Gesundheits- politik war nicht mehr nur Sozialpolitik, sondern wurde zunehmend auch als Beschäftigungs-, Wachstums- und Wettbewerbspolitik für wichtig erachtet. Konträr dazu erwuchs aus der Ökologiebewegung eine Politik der Eindämmung vielfältiger Gesundheitsgefahren in einer Risikogesellschaft (Beck 1986). Die ökologisch vermittelte Sorge um die eigene Gesundheit verband sich bald mit der staatlichen Strategie, dass die Mittelklassen sich um ihre Gesundheit bemühen sollten (Kühn 1993; Petersen und Lupton 1996). Die eigene Gesundheit zu erhalten, wurde bald zur gesellschaftlichen, allerdings höchst ambivalenten Pflicht für alle Bürger (Brunnett 2009; Kickbusch und Hartung 2014).“
Gesundheit als sozialtheoretische Problem: Ernst Bloch als Stichwortgeber für eine erneuerte Kritik der Gesundheitsgesellschaft?
Literaturverzeichnis (noch aufzustellen…)
Stand: 05.06.2024