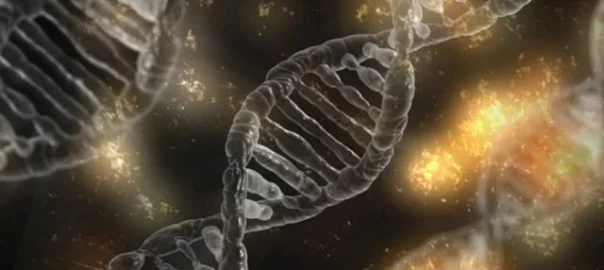Friedrich Heubel, Matthias Kettner und Arne Manzeschke (Hrsg./2010): Die Privatisierung von Krankenhäusern. Ethische Perspektiven, Wiesbaden.
Im Jahre 2010 veröffentlichte die Arbeitsgruppe für Ethik in der Medizin (AEM) in Reaktion auf die erstmalige Privatisierung einer Universitätsklinik (Marburg/Gießen) Ergebnisse ihrer Jahrestagung unmittelbar im Anschluss an diese Privatisierung. Die spektakuläre (Teil-) Privatisierung (zu 95 %) der beiden hessischen Universitätsklinika war jedoch nur der äußere Anlass für die letztlich leitende Frage des Sammelbandes, nämlich: wie ist Krankenhausprivatisierung ethisch zu beurteilen?
Der äußerst lesenswerte Sammelband ist in zwei Teile strukturiert, einmal eine systematische Bestandsaufnahme zum Verständnis von Krankenhausprivatisierungen im deutschen stationären Versorgungssektor. Darauf aufbauend thematisiert ein zweiter Teil in reflexiver Perspektive, wie diese Krankenhauprivatisierungen der vergangenen 20 Jahren kritisch zu bewerten sind, wobei vor allem die materielle Privatisierung als Kernproblem bzw. ernsthafte Herausforderung anzusehen ist.
Krankenhauslandschaft nach Trägern und Rechtsformen
Der erste, systematische Übersicht Artikel von Franziska Prütz beschreibt die stationäre Krankenversorgung in Deutschland im Hinblick auf die Trägerstrukturen und die jeweils gewählten Rechtsformen, die zu einer gewissen Hinsicht in unterschiedlicher Weise miteinander kombiniert werden können. Privatisierung, so schreibt sie (Prütz 2010: 15), enthalte eine begriffliche Doppeldeutung:
„Verwendet man den Begriff der Privatisierung im Zusammenhang mit Krankenhäusern, so kann dies zwei Dinge bedeuten. Meist ist damit ein Wechsel des Krankenhausträgers gemeint, in dem Sinne, dass ein Krankenhaus von einem öffentlichen oder freigemeinnützigen auf einen privaten Träger übergeht. Außerdem kann sich Privatisierung auf die Rechtsform des Krankenhauses beziehen und damit dann die Umwandlung von einer öffentlich-rechtlich in in eine privatrechtliche Unternehmensform“ bedeuten.
Betrachtet man Krankenhäuser aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive vor allem als Unternehmen, so können Sachziele und/oder Formalziele zum Leitbild der jeweiligen Unternehmensphilosophie gemacht werden. Sachziele „beziehen sich dabei auf die Art und Weise, wie die Patientenversorgung geleistet wird (dazu gehören zum Beispiel Bedarfsgerechtigkeit, Kundenfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit), während die Formalziele mit der ‚Zieltriade‘ der Rentabilität, Liquidität und Sekurität an die ‚Teilnahme des Unternehmens am Wirtschaftsprozess und Geldkreislauf‘ anknüpfen.“ (Ebd.: 17) während bis zu dem Gesundheitsstrukturgesetz 1993 die Sachziele die betrieblich-organisatorische Realität in Krankenhäusern beherrschten, orientieren sich zunehmend Krankenhäuser seitdem an Formalziele der Gewinn- oder wenigstens Überschussorientierung.
Franziska Prütz beschreibt ausführlich zunächst die idealtypischen Eigenschaften von freigemeinnützigen, öffentlichen und privatwirtschaftlichen Krankenhäusern – in Anlehnung an eine grundlegende Studie von Markus Wörz (2008) – , um dann akribisch die verschiedenen Rechtsformen in ihren zentralen Merkmalen zu beschreiben (Prütz 2010: 18ff.). Nach der Beschreibung der Entwicklung der Krankenhäuser und Betten im deutschen Gesundheitssystems von 2002-2008 und differenziert nach den voranstehend beschriebenen Rechtsformen, diskutiert sie „Alternativen zur materiellen Privatisierung“ (ebd.: 27ff.), die den Privatisierungsbegriff weiter aus differenzieren. Outsourcing, Public Private Partnerships, formelle Privatisierungsformen, Teilprivatisierungen und der Zusammenschluss zu Krankenhausketten bzw. Krankenhausverbünden als auch die Gründung von Fördervereinen stellen Möglichkeiten dar, wie sich privatwirtschaftliche Akteure am Krankenhausmarkt beteiligen bzw. öffentliche Krankenhausträger privates Kapital inkludieren können.
Die betriebswirtschaftliche bzw. kommunalpolitische Motivation für Privatisierungsprozesse sieht sie vor allem in dem erhofften Ziel auf Effizienzsteigerungen privatisierter Krankenhäuser gegeben. Abschließend – und erneut auf Markus Wörz’ (2008) Studie gestützt – skizziert sie die Unterschiede zwischen den Krankenhäusern unterschiedlicher Trägerschaft im Hinblick auf die Patientenversorgung, die Situation der Beschäftigten, im Hinblick auf Ausbildung, Forschung und Lehre sowie der Wirtschaftlichkeit der Häuser selbst (Prütz 2010: 31ff.). Ihre Kernaussagen sollen hier kurz zusammengefasst werden:
1. Hinsichtlich subjektiver Qualitätsindikatoren, wie zum Beispiel verschiedene Kriterien der Patientenzufriedenheit, zeigten Ergebnisse einer Patientenbefragung im Auftrag der Gmünder Ersatzkasse, dass zwischen den Jahren 2002 und 2005 „die Zufriedenheit mit der Versorgung in privaten Krankenhäusern“ (ebd.: 32) und „die besten Werte […] in freigemeinnützigen Häusern erreicht“ (ebd.) wurden. Obwohl in Deutschland auch objektive Qualitätsindikatoren gesammelt würden und vorlägen, sei bislang keine Auswertung erfolgt. Die berühmte Metaanalyse von Philip J. Devereux et al. (2002) über die Performance von Krankenhäusern in den vereinigten Staaten von Amerika unterstützt die bislang weichen Einschätzungen vorhandener deutscher Studien (Zeitpunkt: 2008!).
2. Die Situation der Beschäftigten in verschiedensten Krankenhäusern unterschiedlicher Trägerschaft lässt sich in Deutschland schon etwas besser abbilden. Als wesentliche Indikatoren können hierbei die so genannte Personalbelastungszahl und die Bezahlung des Personals bzw. Personalkosten herangezogen werden. Die Personalbelastungszahl setzt die Anzahl der zu versorgenden Betten bzw. der zu versorgenden Fälle in einem Jahr in ein Verhältnis zum Personal insgesamt, den ärztlichen Dienst, den Pflegedienst oder medizinisch-technischen Dienst. Die Ergebnisse ihrer Analyse der Krankenhausstatistik des statistischen Bundesamtes zeigt ein eindeutiges Ergebnis: „Es ist festzustellen, dass im Jahr 2008 die Personalbelastung in den freigemeinnützigen und privaten Krankenhäusern am höchsten war, vor allem im Pflegedienst […]. Von den öffentlichen Krankenhäusern wiesen die in privatrechtlicher Form organisierten die höchsten Belastungszahl auf; die niedrigsten Belastungszahlen fanden sich interessanterweise bei den Häusern in öffentlich-rechtlicher Form mit rechtlicher Selbstständigkeit.“ (Prütz 2010: 33) Kaum überraschend ist, dass in jedem vierten privaten Krankenhaus kein Tarifvertrag galt, während der entsprechende Anteil bei öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern erheblich darunter liegt (0,5% bzw. 1,0%). Interessant ist, dass die Personalkosten in privatwirtschaftlich geführten Krankenhäusern niedriger liegen als in ihren freigemeinnützigen und öffentlichen Kontrahenten, aber gleichzeitig die Ärzte in privaten Krankenhäusern leicht mehr verdienen als die Kollegen und Kolleginnen in den Krankenhäusern alternativer Trägerschaft.
3. Die Krankenhausstatistik ermöglicht den Vergleich von Krankenhäusern mit Ausbildungsstätten. Eine entsprechende Analyse von Wörz (2008) zeige, dass in der größten Kategorie von Krankenhäusern – 500 und mehr Betten – private Krankenhäuser den geringsten Anteil an Ausbildungsstätten im Vergleich mit ihren öffentlichen und freigemeinnützigen Konkurrenten hatten.
4. Die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern schließlich, zu deren Verbesserung sich die privatwirtschaftlichen Krankenhäuser bekannt haben bzw. anbiedern (vergleiche auch den Beitrag von Rainer Simbel in diesem besprochenen Sammelband), ist nicht nur international, sondern auch in Bezug auf das deutsche Gesundheitswesen am häufigsten untersucht. Insbesondere ist die mittlerweile mehrfach zitierte Studie von Markus Wörz (2008) hier hervorzuheben. Empirisch vor der Einführung von DRG angesiedelt, kommt er zu der Schlussfolgerung, dass „die öffentlichen Krankenhäuser durchweg die teuersten sind, wenn nicht nach Bettengrößenklassen differenziert wird; dann aber sind die öffentlichen Krankenhäuser nur in den größten Kategorien (500 und mehr bzw. 1000 und mehr Betten) am teuersten […], während die privaten Krankenhäuser in den mittleren (100 bis unter 202, 100 bis unter 500 Betten) am teuersten und in der unteren am günstigsten sind, wenn man Kosten pro Fall kalkuliert. Nicht überraschend erzielen private Krankenhäuser die höchsten Erlöse, wobei wichtig ist hier zu betonen, dass diese Ergebnisse vor der Einführung des administrieren Preissystems, Diagnosis Related Groups, berechnet wurden, nach deren Einführung eine Erlösspreizung nicht mehr möglich ist (s.u.).
Seine Schlussfolgerung ist: „das bedeutet, dass nicht ‚der private Trägerstatus als solcher (…) Die höheren Erlöse verursacht, sondern die Kombination von privatem Trägerstatus und Verbundzugehörigkeit‘“. (Wörz 2008: 202, zit. n. Prütz 2010: 37).
Die etwas jüngere Studie von Tiemann und Schreyögg, die mit einer anderen Methodik arbeitet, kommt sogar zu der Schlussfolgerung, dass die private Trägerschaft mit einer niedrigeren Effizienz im Vergleich zu ihren öffentlichen Kontrahenten einhergeht. Völlig konträr hierzu steht die Studie von Augurzky et al. (2008) zu den privaten Krankenanstalten in Deutschland die eine höhere Insolvenzwahrscheinlichkeit für öffentliche Krankenhäuser errechnet.
Betrachtet man also die verschiedensten Forschungsbeiträge vergleichend, so ergibt sich in mancher Hinsicht ein recht unklares Bild. Nicht überraschenderweise kommt Franziska Prütz (2010: 40) im Hinblick auf die Performance von Krankenhäusern unterschiedlicher Trägerschaft zu der Schlussfolgerung, „dass Forschungsbedarf besteht, besonders auf dem Gebiet der Versorgungsqualität, um die Frage zu klären, ob eher – wie es den Anschein hat – von einem Trade-Off zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit auszugehen ist oder beides miteinander einhergeht. Bezüglich der Wirtschaftlichkeit wird die Hypothese, dass der private Trägerstatus mit einer höheren Effizienz verbunden ist, zunehmend infrage gestellt.“
Krankenhäuser als Wirtschaftseinheiten – ökonomische Aspekte und Herausforderungen
Der Beitrag von Rainer Sibbel in dem besprochenen Sammelband sticht in ungewöhnlicher Weise heraus. Das gilt weniger für die theoretische Ausarbeitung und empirische Fundierung des Textes als für die positive Bewertung von Privatisierungsprozessen im deutschen Krankenhaussektor, die ein wenig quer steht zu den ansonsten recht kritischen Äußerungen und Beiträgen über Privatisierungsprozesse im Krankenhaussektor (wenig überraschend sucht man den Namen von Rainer Sibbel unter der abschließenden Stellungnahme der Arbeitsgruppe am Ende des Bandes, S. 195ff., vergeblich).
Der Beitrag ist demgemäß vor allem unter ideologiekritischen Gesichtspunkten von Interesse, konstruiert er doch ein recht grobschlächtiges Narrativ, das zwar nicht völlig plump die grundsätzliche Überlegenheit privatwirtschaftlich geführter Krankenhäuser in den Mittelpunkt stellt, sondern einem professionellen Management von Krankenhäusern, das sich freilich an erfolgreichen privatwirtschaftlich geführten Krankenhäusern ausrichtet, den entscheidenden Faktor zubestimmt bzw. zuweist, ein erfolgreiches Krankenhausmanagement durchzuführen. Hinter dem Rücken kommt dann aber eben doch das Narrativ des effizienteren privaten Krankenhaussträger hervor (kritisch zu diesem verbreiteten Narrativ: Mosebach 2013).
Seine Argumentation laviert mehrfach hin und her. Die wesentlichen Bausteine seiner Argumentationsganges sind (i) die Beschreibung des Strukturwandels im Gesundheitswesen als trägerübergreifende Rahmenbedingungen, (ii) die Skizze der Motive von Privatisierungen öffentlicher Krankenhäuser, (iii) der Stand der Privatisierung von Krankenhäusern in Deutschland und (iv) der Versuch, die Zunahme von Privatisierungsprozessen durch spezifische Erfolgsfaktoren privater Klinikbetreiber zu erklären.
ad 1) Unter Verweis auf seine eigene Habilitationsschrift (Sibbel 2004) beschreibt Rainer Sibbel zunächst sechs zentrale Faktoren, die als Treiber des Strukturwandels im Gesundheitswesen fungieren. Hierzu gehören neben den üblichen Verdächtigen, demographische Entwicklung und medizinischer bzw. medizinisch-technischer Fortschritt, auch Internationalisierungs- und Privatisierungsprozesse (Globalisierung) sowie der Wertewandel innerhalb der Gesellschaft, der mit anspruchsvolleren Konsumenten einhergeht – auch ein Bestandteil eines internationalisierten Narrativs – und schließlich noch gesetzliche Rahmenbedingungen, mit denen die Kostendämpfung einerseits und die Einführung des DRG-Systems andererseits gemeint ist. Der ökonomische Druck auf öffentlich geführte Krankenhäuser nimmt durch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen und die kostentreibenden Randbedingungen erheblich zu, so dass schließlich sich öffentliche Träger für eine materielle Privatisierung von Krankenhäusern entscheiden.
Hiermit „… zieht sich der öffentliche Träger aus der Verantwortlichkeit für die Leistungserstellung zurück, letztlich weil alle anderen Handlungsoptionen – wie beispielsweise eine formelle Privatisierung, das heißt die Umwandlung von öffentlich betriebenen Kapitalgesellschaften – als weniger zielführend bzw. Erfolg versprechend erscheinen bzw. sich als solches erwiesen haben.“ (Sibbel 2010: 45)
Die Zielsetzung des Gesetzgebers – wie er unmittelbar davor schreibt – sind die „kontinuierliche Erhöhung des Kosten- und Wettbewerbsdrucks, die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung in den Versorgungseinrichtungen zu verbessern, sektorenübergreifende integrierte Leistungsstrukturen zu fördern und gleichzeitig die Leistungsqualität transparenter zu machen.“ (Womit en passant alle ideologischen Bausteine der hegemonialen Strategie der wettbewerbsbasierten Kostendämpfungspolitik aufgebaut worden sind: Mosebach 2018) Der vorstehende ausführlich zitierte Textausschnitt suggeriert natürlich, dass die Zielsetzungen des Gesetzgebers am besten durch die materielle Privatisierung von Krankenhäusern erreicht werden. Genau das versucht Sibbel mit dem zweiten Baustein seines argumentativen Baukastens zu begründen.
ad 2) Gleich zu Beginn seines zweiten Bausteins überrascht der Autor mit der beiläufig hingeworfenen Bemerkung, dass „regulatorische Ansätze und öffentlich geprägte Strukturen“ sich als häufig „(zu) schwierig bzw. zu beharrlich“ erweisen würden, „um Qualitäts- und Effizienzpotenziale in ausreichendem Maße und zeitgerecht zu realisieren“ (ebd.: 46). Die Deregulierung und Einführung von Markt- bzw. Wettbewerbsprinzipien würde besonders durch die Privatisierung angeheizt. Diese Aussagen sind relativ evidenzfrei, vor allem wenn man die empirischen Ergebnisse des vorherigen Beitrags von Franziska Prütz reflektiert.
Das zweite Motiv für Krankenhauprivatisierungen, auf das Sibbel hinweist, handelt von den Entlastungen der öffentlichen Haushalte. Eine empirische Betrachtung zahlreicher Privatisierungsprozess von Krankenhäusern in einer Parallelveröffentlichung zu dieser Zeit legt auch hinsichtlich dieses zweiten Arguments eine gewisse Skepsis nahe. Einige Fallstudien aus dem Sammelband „Privatisierung von Krankenhäusern“ (Böhlke et al., Hamburg 2009) unterstützen eher die Interpretation, dass manche Privatisierungsprozesse zumindest mittelfristig mit erheblichen Finanzierungsrisiken für die öffentlichen Haushalte einhergegangen sind, da betriebliche Pensionslasten und vage Investitionszusagen die öffentlichen Haushalte keineswegs so sehr entlastet haben, wie der hier besprochenen Beitrag suggeriert.
Öffentliche Träger intervenieren Sibbel zu Folge zudem zu stark in die strategischen Entscheidungen von Krankenhausträgern, so dass das unprofessionelle Management von öffentlichen Krankenhäusern maßgeblich für die Defizite dieser Krankenhäuser sei. Dieses Argument ist wegen manifester historischer Ungenauigkeit und offensichtlichzem theoretischem Unverständnis recht irritierend. Zunächst gilt dieses Argument grundsätzlich nur für öffentliche Krankenhäuser in öffentlicher, und zwar vor allem nicht-selbständiger, Rechtsform. Wie Franziska Prütz in Ihrem vorhergehenden Beitrag nachdrücklich gezeigt hat, ist es das Ziel von formalen Privatisierungsprozessen, genau diese enge Bindung des Krankenhausmanagements von öffentlichen Einrichtungen an die politischen Entscheidungsträger zu überwinden. Dass öffentliche Träger trotz formaler Privatisierung immer noch zu viel intervenieren, müsste erst einmal empirisch nachgewiesen werden; das macht Sibbel jedoch nicht. Insofern ist die Aussage von Rainer Sibbel aufgrund der massiven Ausweitung formaler Privatisierungen hier mutmaßlich historisch überholt und folglich argumentativ leer.
Die argumentativen Leerhülsen gehen im Folgenden fröhlich weiter. Kein Argument ist zu dünn bzw. schlecht belegt, um die Überlegenheit von materiellen Privatisierungsprozessen anzupreisen. Zum einen hindere die Verfolgung des Sachziels: Versorgungsbedarfsdeckung die öffentlich geführten Krankenhäuser daran, ihre hierarchischen Organisationsstrukturen zu überwinden, eine bessere Kooperation zwischen den beteiligten Berufsgruppen zu etablieren und ihre Personalkosten zu senken. Angeblich alles Faktoren, die bei privatwirtschaftlich geführten Krankenhäusern besser sind – wie Sibbel natürlich unter Verweis auf die üblichen RWI- Auftragsstudien der privaten Krankenhausverbände zu belegen behauptet. Im DRG-System werden auch die Formalziele bei freigemeinnützigen und öffentlichen Krankenhäusern aufgewertet, zumal das Sachziel für sich genommen kaum für eine qualitativ hochwertige Versorgung genügen dürfte. Sibbel verweist selbst darauf, dass beide Ziele bei allen Trägern unter den neuen krankenhauspolitischen Bedingungen wichtig sind (Sibbel 2010: 51). Umso unverständlicher ist seine hier behauptete enthistorisierte Ineffizienz öffentlicher Krankenhausträger.
Unter Bezugnahme auf das SVR-Gesundheit 2001 behauptet Sibbel weiter, das „durch die mangelnde Prozessorientierung und Standardisierung sowie eine häufig ineffiziente veralteter Infrastruktur“ „die Selbstfinanzierungskraft des Krankenhauses durch eigenen erwirtschaftete Überschüsse insgesamt stark geschwächt [würde] bzw. […] nicht in ausreichendem Maße erschlossen werden“ könne (Sibbel 2010: 48). Seine Einschätzung der Gründe für die Privatisierung öffentlich geführter Krankenhäuser scheint eindeutig, wiederholt aber nur das leere Mantra dieses argumentativen Bausteins: „Letztlich erweisen sich die Defizite öffentlicher Strukturen aber häufig als zu groß, weshalb trotz der durchaus hohen Zahl formeller Privatisierungen letztlich [SIC!] oft doch der Verkauf des Krankenhauses einen privaten Träger die Ultima Ratio darstellt und erfolgt.“
ad 3) Im dritten Unterabschnitt, der mit „Stand der Privatisierung von Krankenhäusern in Deutschland“ (ebd.: 48) überschrieben ist, geht es nur am Rande um diesen Punkt. Eigentliches Thema ist die Spannung zwischen dem krankenhauspolitischen Oberziel der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen, wie es im Krankenhausfinanzierungsgesetz niedergelegt ist (§ 1 Abs. 1 KHG), einerseits und dem betriebswirtschaftlichen Kernziel eines jeden Unternehmens, der „langfristige[n] Existenzsicherung als universelle[r] oberste[r] Zielsetzung“ (ebd.: 49) andererseits. Traditionellerweise werden in betriebswirtschaftlicher Hinsicht Formalziele (Erfolgsziele, Finanzziele) von Sachzielen (Leistungszielen, ethische Ziele) unterschieden. Während privatwirtschaftlich geführte Krankenhäuser eher den Formalzielen nacheifern, zielen öffentlich-rechtliche als auch freigemeinnützige Krankenhäuser eher auf die Erfüllung versorgungsbezogener Sachziele.
„Für öffentliche und freigemeinnützige Krankenhäuser ist finanzieller Erfolg Grundlage, um auch in Zukunft leistungsfähig im Sinne der Sachziele zu sein. Private Träger hingegen haben eher die Möglichkeit, die Sachziele so auszurichten, dass eine hohe Zielerreichung bei den Formalzielen daraus resultiert. Beiden muss aber bewusst sein, dass nur ein ‚Spielen auf beiden Manualen‘ langfristig die Existenz sichert.“ (Sibbel 2010: 51)
Dieses Zitat ist bemerkenswert. Im Grunde genommen sagt es aus, dass privatwirtschaftliche Krankenhäuser vor allem gewinnorientiert agieren. Wieso, so stellt sich Rainer Sibbel die Frage, konnte die Anzahl privatwirtschaftlicher Krankenhäuser in Deutschland dann derart wachsen, obwohl ein Teil der Gewinne „an die Anteilseigner […] als Renditen ausgeschüttet“ (ebd: 52) werden musste. Eine wirklich überzeugende Antwort liefert er an dieser Stelle nicht. Im Grunde sagt er, dass durch den hohen Kostendruck und die Steigerung der Leistungsverdichtung in privatwirtschaftlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern „ein höheres Effizienzniveau in ihrer Leistungserstellung“ (ebd.: 54) erreicht werden konnte (zu möglichen Qualitätseinbußen sagt er nichts). Wieso sind dann nicht die freigemeinnützigen Krankenhäuser in gleichem Maße gewachsen wie die privatwirtschaftlichen Krankenhäuser? Wie – so die auf den Nägel brennende Frage – kommt die höhere Effizienz zustande? (Beiläufig sei erwähnt, dass der Beitrag von Franziska Prütz zeigt, dass die Behauptung einer höheren Effizienz von privatwirtschaftlichen Krankenhäusern fragwürdig wird)
ad 4) Im letzten Absatz seines Beitrags widmet sich Rainer Sibbel (2010: 54ff.) den „Erfolgsfaktoren privater Klinikbetreiber“ (ebd.: 54) Und verwirrt den Leser zugleich mit einer knalligen Einschränkung: es lasse sich „kaum allgemein und vollends evidenzbasiert nachweisen, was die Erfolgsfaktoren privater Klinikbetreiber sind“ (ebd.). Der weitere Argumentationsgang ist nicht weniger kurios. Man höre und staune: der Erfolg der privatwirtschaftlichen Krankenhäuser lasse sich erstens aus den Schwächen, „die Institutionen allgemein und Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft in besonderen zugeschrieben [SIC!] werden“ klar ableiten! Jetzt kommt es – zweitens – mit Knall: „Als marktbezogene Erfolgsfaktoren wird privaten Krankenhäusern und Trägern eine deutlich klarere und systematische Patienten-, Markt- und Wettbewerbsorientierung zugesprochen [SIC hoch 2], die bei einer Vielzahl von Fragen des strategischen Managements ansetzen.“ (Ebd.) Man reibt sich verwundert die Augen. Der Markterfolg der privatwirtschaftlichen Krankenhäuser beruht nur auf einem mehr oder weniger zugeschriebenen oder zugesprochenem Hörensagen?
In diesem ideologischen Freistil, der völlig evidenzfrei losmarschiert, geht es fröhlich weiter. Nicht, dass seine präsentierte empirische Evidenz fragwürdig wäre – es werden an dieser zentralen Stelle seines Textes schlicht keine Studien, die seine Argumentation stützen könnten, zitiert. Vielleicht verwechselt Rainer Sibbel die angloamerikanische und deutsche Bedeutung des Wortes evident. Zudem behauptete er, „Patientensicherheit und Qualitätsmanagement werden ggf. [SIC hoch 3] deutlich strukturierter und systematischer angegangen“ (ebd.), das Einweisermanagement und die Kommunikation mit den niedergelassenen Ärzten werde optimiert („Beziehungspflege“).
„Insgesamt erweisen sich private Träger bzw. Krankenhäuser häufig als flexibler und zukunftsorientierter im Hinblick auf die Entwicklungen im Gesundheitssystem und dessen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Entwicklung und Diskussion rund um medizinische Versorgungszentren zeigt.“ (Ebd.).
Genau. Das ist ja evident. Was also sind seine Argumente? Ernst genommen, behauptet er, dass sich privatwirtschaftliche Krankenhäuser systematisch dem besseren Krankenhausmanagement verschreiben, wie er dankenswerterweise in seiner Habilitationsschrift gezeigt hat (er zitiert sich wirklich als einzige Quelle an dieser Stelle!). Aber die Beschreibung, wie etwas perfekt läuft bzw. laufen sollte oder könnte (präskriptive Unternehmensberatung), hat mit der realen Entwicklung nur bedingt etwas zu tun. Hier wird in klassischer Weise das Modell für die Realität gehalten. Nicht zu Unrecht ist eine solche Verwechslung von Realität und naivem Modelldenken als Modellplatonismus bezeichnet worden. Bestenfalls – und mit mehrfach gekreuzten Fingern – lassen sich seine Aufzählung theoretisch konstruierter und präskriptiv angepriesener Erfolgsfaktoren als „Hypothesen“ für Forschungsprojekte über mögliche Erfolgsfaktoren rechtfertigen. Um dies zu tun – und der Rezension eines weitgehend hilflosen Textes eine positive Wendung zu geben – wird der zentrale Absatz seiner Arbeit hier wörtlich zitiert (ebd.: 55):
„Als maßgebliche Erfolgsfaktoren aus produktions- und kostenorientierter Perspektive ist die konsequente Nutzung von Synergien und Vorteilen zu nennen, die sich einerseits aus Marktmacht und Unternehmensgröße, beispielsweise in der Beschaffung, erschließen lassen und die andererseits auf Spezialisierungs- und Erfahrungskurveneffekten basieren. Dazu zählen gerade auch Ansätze zur Standardisierung der Leistungsprozesse beispielsweise mit Hilfe von Clinical Pathways oder Checklisten sowie eine an den Prozessen ausgerichtete Organisations- und insbesondere auch Infrastruktur [Selbstzitat: hier]. Das geht häufig einher mit gezielten Strategien zur Personalakquisition wie zur Fort- und Weiterbildung [f&w-Beitrag zitiert]. Entscheidend dafür, die angeführten Erfolgspotentiale umsetzen und ausnutzen zu können, ist die gerade auf Seiten privater Träger oftmals vorhandene hohe Finanzkraft und Investitionsfähigkeit gepaart mit klareren Entscheidungs- und Rechtstrukturen, die es erlaubt, Zielsetzung gerechter und schneller auf veränderte Anforderungen und Potenziale reagieren zu können [SIC hoch 4]. Grundpfeiler insbesondere des wirtschaftlichen Erfolgs gerade der privaten Krankenhausbetreiber in einem DRG-System, d.h. bei pauschalierten Leistungsentgelte, ist die Effizienz der Leistungserstellung.“
Ein wahrlich grußeliger Absatz. Und nun kippt die Argumentation erneut. In dem letzten Absatz dieses vierten Abschnitts behauptete er – und damit seine ganze bisherige Argumentation auf den Kopf stellend –, dass der Erfolg der privatwirtschaftlichen Krankenhäuser vor allem auf den Schwächen und dem Beharrungsvermögen der öffentlich-rechtlichen Strukturen und Krankenhäuser beruhe. Mit einem Mal ist es jetzt plötzlich nicht mehr die Trägerschaft, die entscheidend ist, sondern die professionelle Führung (die man ja auch beraten kann!). Nachdem eben noch die privatwirtschaftlichen Krankenhäuser strukturell besser waren, ist es jetzt plötzlich nur noch das Management:
“ Wie sehr auch immer diese verschiedenen Faktoren im einzelnen oder in ihrer Wechselwirkung den Erfolg von Krankenhäusern und Klinikketten in privater Trägerschaft ausmachen, letztlich erscheint keiner der genannten Faktoren so zwingend und nachhaltig, dass Krankenhäuser in öffentlichen Strukturen unter professioneller Führung und mit entsprechend motivierten Personal diese nicht auch anstreben und realisieren könnten, die letztlich einige Beispiele öffentlicher Krankenhäuser und Krankenhausverbände auch zeigen.“ (Ebd.: 56)
Kein Wunder, dass ihn die anderen Autoren in der abschließenden Stellungnahme der Arbeitsgruppe nicht dabeihaben wollten. Es ist ein sehr dürftiger Beitrag zur Diskussion um Privatisierungsprozesse im deutschen Krankenhauswesen.
Krankenhausprivatisierung: auch unter DRG-Bedingungen ein Erfolgsmodell?